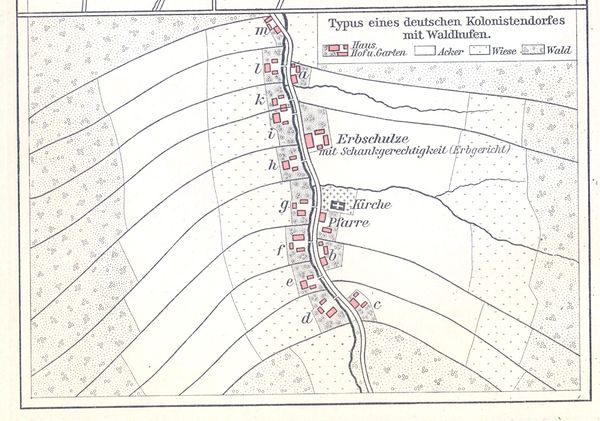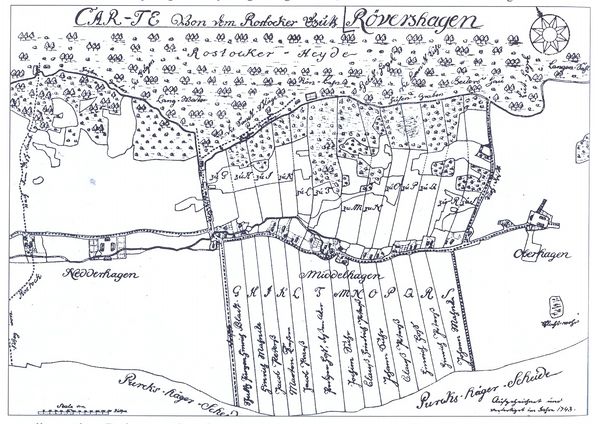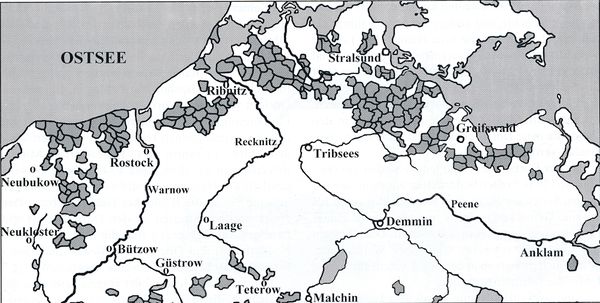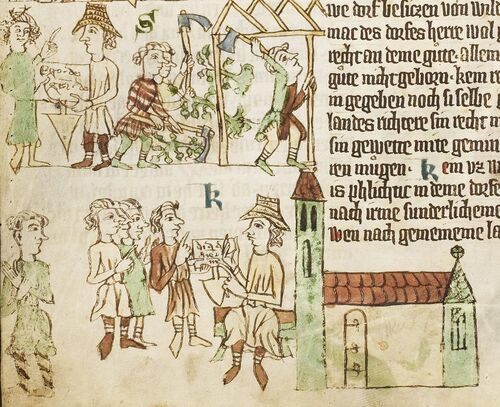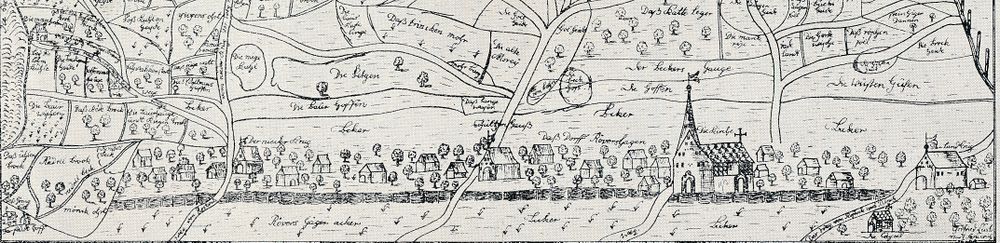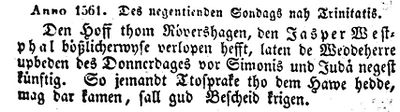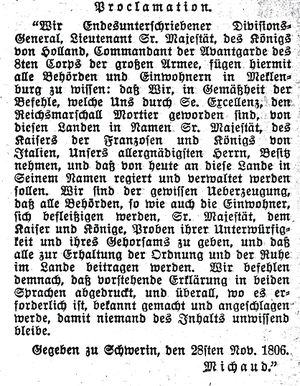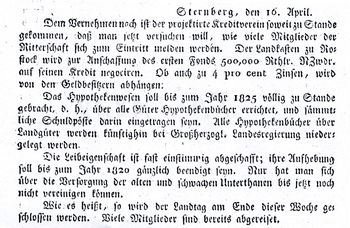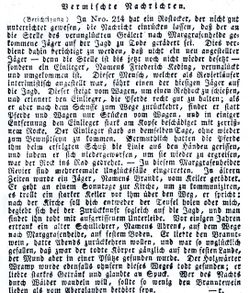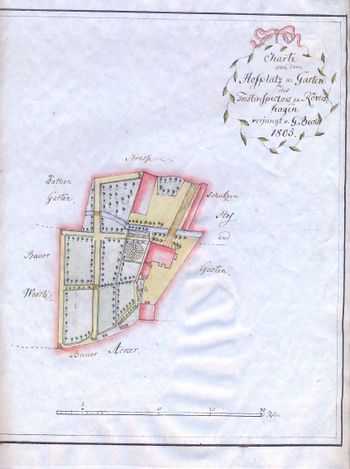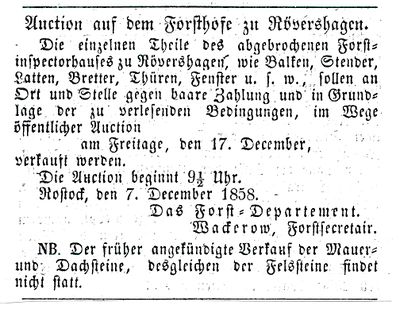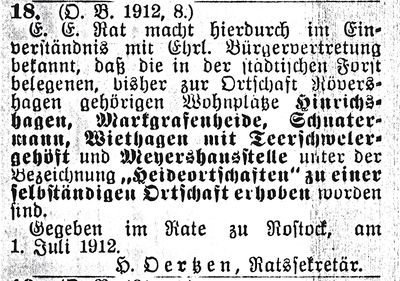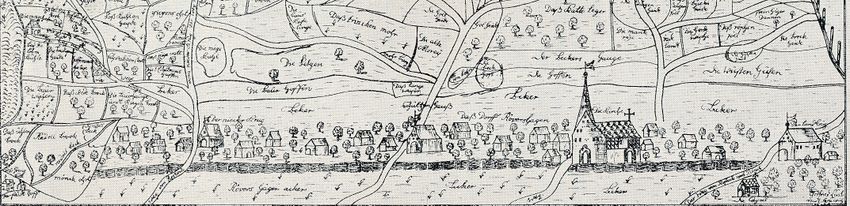Fortlaufende Chronik des Dorfes Rövershagen: Unterschied zwischen den Versionen
| Zeile 65: | Zeile 65: | ||
[[ Datei:Sachsenspiegel-Ostsiedlung.jpg |thumb|500px|rechts| Eine Szene aus dem Sachsenspiegel zeigt einen Lokator (mit Hut) während der deutschen Ostsiedlung um 1300 (aus Eike von Repgow) Sachsenspiegel-Ostsiedlung ]] | [[ Datei:Sachsenspiegel-Ostsiedlung.jpg |thumb|500px|rechts| Eine Szene aus dem Sachsenspiegel zeigt einen Lokator (mit Hut) während der deutschen Ostsiedlung um 1300 (aus Eike von Repgow) Sachsenspiegel-Ostsiedlung ]] | ||
| − | [Was ist ein Lokator (aus Wikipedia)] | + | [[Was ist ein Lokator (aus Wikipedia)]] |
| + | |||
Der Lokator (lat. locator: Verpächter, Grundstücksverteiler, von lat. (col)locare „zuweisen“, „vermieten“, „errichten“, „ansiedeln“; auch magister incolarum; in Mecklenburg und Pommern auch possessor oder cultor, ähnlich dem Reutemeister in Süddeutschland) war ein mittelalterlicher Subunternehmer, der meist im Auftrag eines Landes- oder Grundherrn für die Urbarmachung, Vermessung und Zuteilung von zu erschließendem Land verantwortlich war. Darüber hinaus warb er Siedler für diese Zwecke an, stellte für die Übergangszeit (z. B. während der Rodung) den Lebensunterhalt zur Verfügung und besorgte Arbeitsmaterialien und -geräte (Saatgut, Zugtiere, Eisenpflüge u. a.). Er spielte somit eine wichtige Rolle bei der Gründung von Städten und Dörfern sowie der Urbarmachung von unbewirtschaftetem Land während der Binnenkolonisation in Norddeutschland und der deutschen Ostsiedlung und war somit an deren Erfolg beteiligt. | Der Lokator (lat. locator: Verpächter, Grundstücksverteiler, von lat. (col)locare „zuweisen“, „vermieten“, „errichten“, „ansiedeln“; auch magister incolarum; in Mecklenburg und Pommern auch possessor oder cultor, ähnlich dem Reutemeister in Süddeutschland) war ein mittelalterlicher Subunternehmer, der meist im Auftrag eines Landes- oder Grundherrn für die Urbarmachung, Vermessung und Zuteilung von zu erschließendem Land verantwortlich war. Darüber hinaus warb er Siedler für diese Zwecke an, stellte für die Übergangszeit (z. B. während der Rodung) den Lebensunterhalt zur Verfügung und besorgte Arbeitsmaterialien und -geräte (Saatgut, Zugtiere, Eisenpflüge u. a.). Er spielte somit eine wichtige Rolle bei der Gründung von Städten und Dörfern sowie der Urbarmachung von unbewirtschaftetem Land während der Binnenkolonisation in Norddeutschland und der deutschen Ostsiedlung und war somit an deren Erfolg beteiligt. | ||
<br clear="all"> | <br clear="all"> | ||
Version vom 7. Februar 2025, 16:05 Uhr
Rövershagen ist ein Hagendorf
- (Gründung der Hagendörfer im 13. und 14. Jahrhundert. (Hans Erichson/ Wilfried Steinmüller)
- Bei der deutschen Ostkolonisation des 13. Jahrhunderts spielte neben der Gründung der Städte auch die Anlage neuer Dörfer eine wichtige Rolle.
- Die eroberten Gebiete der Obotriten und Lutizen waren nur dünn besiedelt. Die Wenden, wie die Slawen auch genannt wurden, siedelten vorwiegend auf leichten Böden und in der Nähe von Gewässern.
- Weite Teile des Landes waren vor 700 bis 800 Jahren noch mit undurchdringlichen Wäldern bedeckt.
- Die deutschen Siedler übernahmen in der Regel nicht die wendischen Siedlungen, der größte Teil der deutschen Dörfer entstand „aus frischer Wurzel“ durch Waldrodung.
- Diese deutschen Rodungsdörfer sind meist an den Endungen „-hagen“ zu erkennen und werden deshalb auch als Hagendörfer bezeichnet.
- Solche Hagendörfer finden wir vor allem im Gebiet der fruchtbaren Grundmoränen nördlich der mecklenburgischen Hauptendmoräne.
- Gehäuft treten Hagendörfer im Klützer Winkel, im „Hägerort“ zwischen Doberan und Rostock, am Südrand der Rostocker Heide zwischen Rostock und Ribnitz sowie zwischen Damgarten, Barth und Greifswald auf.
- Man schätzt die Hagendörfer im heutigen Land Mecklenburg-Vorpommern auf 400. Es gibt Grund zu der Annahme das diese sich von West nach Ost wie eine Perlenkette erstreckenden Regionen auch in auf einander folgenden Besiedlungswellen entstanden sind.
- Auffallend ist, dass nach der Schlacht von Bornhoeved 1227 und der damit endenden dänischen Lehnsabhängigkeit die deutsche Siedlungstätigkeit sprunghaft zunahm.
- Naheliegend ist auch, dass ab dem 13. Jahrhundert der später als "Danziger Botenweg" bekannt gewordene Handels- und Heerweg als Einfallsstraße für die Siedler mit den jeweiligen Siedlungswellen konform nach Osten ins Land hinein gewachsen ist.
- So entstanden rein slawische und deutsche Siedlungskorridore neben einander.
- In der Urkunde aus dem Jahre 1233 (MUB 421), in der die Rede von dem Zehnten in Ribnitz und im Kirchspiel Ribnitz ist, wird auch der Zehnt von 16 Hufen „in den Hagen, als Blankenhagen, Volkershagen und Wulfardeshagen“ genannt.
- Diese Urkunde stellt uns mitten hinein in die Zeit der Kolonisation unserer engeren Heimat.
In den eroberten Gebieten gehörte der Grund und Boden dem Landesherrn.
- Er belehnte damit seine Vasallen, die Ritter, die dafür dem Landesfürsten Kriegsdienste zu leisten hatten.
- Auch die Kirche und die Klöster sowie die Städte erhielten Grundbesitz vom Fürsten.
- Die Felder, Wälder, Wiesen und Moore gehörten also immer einem Grundherrn: dem Fürsten, einem Adligen, der Kirche oder einer Stadt.
- Die Grundherrn konnten aber nur Abgaben und andere Einkünfte erzielen, indem sie auf ihrem Land Bauern ansiedelten.
- Bei der Gründung eines Dorfes stellte also der Grundherr das Land zur Verfügung und beauftragte meistens einen erfahrenen „Lokator“ - wir würden heute Siedlungsunternehmer sagen - mit dem Siedlungswerk.
- Der Lokator warb in Niedersachsen, Westfalen oder Friesland auswanderungswillige junge Bauernsöhne, die in ihrer alten Heimat keinen Hof erhalten konnten, auch Kätner, landlose Knechte und andere Leute und führte sie mit ihren Familien in die neue Heimat.
- Auffallend viele angeworbene Neusiedler kamen aus dem Gebiet des Weserberglandes.
- Der Lokator stammte oft aus dem Bauernstand, war manchmal auch adliger Herkunft.
- Er erhielt in dem neuen Dorf das Schulzenamt und zwei Hufen Land.
- Nachdem die Flurgrenzen des neuen Dorfes abgesteckt waren, schlugen die Siedler zuerst eine Schneise in den Wald, die neue Dorfstraße, welche fast immer entlang eines Baches verlief.
- An der Dorfstraße wurde jedem Siedler ein etwa 100 bis 150 m breiter Waldstreifen zugeteilt, der auf beiden Seiten der Straße und ca. rechtwinklig zu ihr bis an die Gemarkungsgrenze reichte.
- Jeder Bauer errichtete auf seiner Hufe das Gehöft. Dann begann die unsäglich schwere Arbeit der Waldrodung. Allmählich drängte man den Wald Schritt für Schritt bis an die Dorfgrenze zurück.
- Eine solche Hagenhufe war in der Regel ein über 1500 m langer Streifen, der von einer Gemarkungsgrenze bis zur anderen reichte. In solchen Waldhufen- oder Hagendörfern lagen die Gehöfte in regelmäßigen Abständen aneinandergereiht entlang der Dorfstraße.
- Solche oft über mehrere Kilometer langen Hagendörfer aus dem 13. Jahrhundert können wir verschiedentlich im Bild der heutigen Dörfer erkennen.
- Beispiele dafür sind Rövershagen, Mönchhagen oder Willershagen.
- Viele Hagendörfer wurden besonders im 17. und 18. Jahrhundert ganz oder teilweise in Gutsdörfer verwandelt, so dass der bäuerliche Charakter verlorenging.
- Die leibeigenen Bauern wurden „gelegt“ und ihr Acker dem Gutshof zugeschlagen.
- Das betraf hier zum Beispiel Niederhagen und Oberhagen.
- In anderen Dörfern wurden im vorigen Jahrhundert durch die Flurbereinigung die Feldmarken neu eingeteilt, so daß die ursprünglichen Hagenhufen verändert wurden.
- Eine Flurkarte des Hagendorfes Mittel-Rövershagen aus dem Jahre 1743 zeigt noch sehr deutlich die Hagenhufen, die von der Purkshäger Scheide bis an die Rostocker Heide reichten.
- Der etwas breitere Streifen in der Dorfmitte ist die Prediger-Hufe.
- Dagegen sind die beiden Dorfteile Nedderhagen und Oberhagen (Nieder- und Ober-Rövershagen) bereits in Gutshöfe verwandelt.
- Ein typisches Merkmal der Hagendörfer sind die Ortsnamen, die in der Regel aus einem Personennamen (oft wohl der Name des Lokators) und der Endung -hagen bestehen.
- Dafür finden wir in unserer Umgebung zahlreiche Beispiele: Völkshagen, Wulfshagen, Bartelshagen und auch Klockenhagen.
- Bei Klockenhagen dürfte der Lokator Klok (hochdeutsch Kluge) geheißen haben. Aus „Klokhaghen“ und „Clochagen“ entstand dann Klockenhagen.
- Die hier in den Hagendörfern angesiedelten Bauern hatten günstigere Besitzrechte als die in ihrer alten Heimat.
- Zwar gehörte der Grund und Boden immer einem Grundherren, dem Fürsten, einem Adligen, der Kirche oder einer Stadt, aber die Bauern konnten den Hof vererben, ja sogar verkaufen.
- Der größere Teil saß zu Erbzinsrecht auf ihren Höfen, nur ein geringer Teil saß auf Zeitpacht. :Die Bauern hatten ihrem Grundherren bestimmte Abgaben zu entrichten und Dienste zu leisten. :Diese Dienste waren aber im Mittelalter nicht so drückend, weil die Eigenwirtschaften der Ritter noch nicht so umfangreich waren.
- Im 16. und 17. Jahrhundert verschlechterte sich die rechtliche Lage der Bauern, so dass sie dann überschuldet und zu Leibeigenen herabgedrückt (abgemeiert) wurden.
Die Hagendörfer treten gehäuft im Hägerort zwischen Kühlung und Breitling. am Südrande der Rostocker Heide und zwischen Damgarten und Greifswald auf.
Was ist ein Lokator (aus Wikipedia)
Lokator (Aus Wikipedia)
Was ist ein Lokator (aus Wikipedia)
Der Lokator (lat. locator: Verpächter, Grundstücksverteiler, von lat. (col)locare „zuweisen“, „vermieten“, „errichten“, „ansiedeln“; auch magister incolarum; in Mecklenburg und Pommern auch possessor oder cultor, ähnlich dem Reutemeister in Süddeutschland) war ein mittelalterlicher Subunternehmer, der meist im Auftrag eines Landes- oder Grundherrn für die Urbarmachung, Vermessung und Zuteilung von zu erschließendem Land verantwortlich war. Darüber hinaus warb er Siedler für diese Zwecke an, stellte für die Übergangszeit (z. B. während der Rodung) den Lebensunterhalt zur Verfügung und besorgte Arbeitsmaterialien und -geräte (Saatgut, Zugtiere, Eisenpflüge u. a.). Er spielte somit eine wichtige Rolle bei der Gründung von Städten und Dörfern sowie der Urbarmachung von unbewirtschaftetem Land während der Binnenkolonisation in Norddeutschland und der deutschen Ostsiedlung und war somit an deren Erfolg beteiligt.
Grundlagen, Aufgaben und Vorgehensweise
- Auftrag zur Besiedlung
Der Auftrag zur Besiedlung des zu erschließenden Landes erfolgte zumeist durch einen adligen oder geistlichen Landesherren bzw. durch einen Grundherrn, der hierfür vorher die landesherrliche Genehmigung einzuholen hatte.[1] Allerdings wurden auch Dörfer ohne vorherige Erlaubnis an Lokatoren zur Urbarmachung ausgesetzt oder Siedler handelten auf eigene Faust. Bezüglich der Aufgaben bei der Urbarmachung und Stellung in der neuen Siedlung ist es von Bedeutung, zwischen Stadtlokatoren und Dorflokatoren zu differenzieren.
- Rechtliche Grundlagen
Die rechtliche Grundlage für die Entstehung einer neuen Siedlung bildete der Lokationsvertrag (lat. locatio).[2] Dieser wurde entweder direkt zwischen dem Landesherrn und dem beauftragten Lokator geschlossen oder zwischen Grundherr und Lokator. Im Lokationsvertrag wurden die vorher mit dem Landesherrn abgesprochenen Lokationsprivilegien sowie die Zehntregelungen u. ä. festgehalten.[3] Vertraglich wurde somit der Rechts- und Organisationswechsel (bei den deutschen Ostsiedlungen der Wechsel vom polnischen zum deutschen Recht), Vergünstigungen für Lokator und Siedler sowie Pflichten und steuerliche Abgaben geregelt. Hierzu gehörte auch die Vorgabe, die Felder gegen Überschwemmungen oder andere Natureinflüsse zu sichern oder die Siedlung z. B. durch das Ausheben eines Grabens gegen Feinde zu schützen. Der Lokationsvertrag hatte für Siedler und Lokator somit eine verpflichtende Wirkung gegenüber dem Grundherrn, bildete aber auch eine gesetzliche Grundlage, die rechtliche Sicherheit für die Siedlung und ihrer Bewohner bedeutete. Oftmals beinhaltete die locatio auch Strafklauseln, die im Falle einer gescheiterten Besiedlung den Entzug der Privilegien und eine Geldstrafe für den Lokator nach sich zogen.
- Soziale Stellung
Lokatoren gehörten hauptsächlich dem niederen Adel oder der Schicht der Stadtbürger an. Sie waren Ritter oder Vasallen der Landesherren. Oft waren es auch Personen, die angesehenen Berufen nachgingen, wie Münzmeister oder königliche Dienstmänner. Zudem verfügten sie meist über hinreichend Erfahrung bzw. eine in der damaligen Zeit gute Ausbildung. Es gibt auch Berichte über einfache Bauern, die sich als Lokatoren betätigten, diese Vorgehensweise war jedoch eher unüblich. Denn meist mussten die Lokatoren über ein größeres Vermögen und über gute gesellschaftliche Verbindungen verfügen. Die Grund- und Landesherren bevorzugten es, Lokationsaufträge an Personen zu vergeben, die keine oder nur geringfügige finanzielle Unterstützung benötigten, um so ihr eigenes Risiko zu minimieren.
- Vorgehensweise und Aufgaben
Der Lokator kann als Mittelsmann zwischen Grundherrn und Siedlern bezeichnet werden, der in erster Linie für die Anwerbung zuständig war. Oftmals leitete oder unterstützte er die vom Grundherrn eingeleitete Werbekampagne. Den Aufbau der zu entstehenden Ortsanlage führte er in eigener Regie und Verantwortung durch und verteilte die Aufgaben im Zuge der Urbarmachung.
Zu den grundlegenden Aufgaben des Lokators gehörten zudem das Vermessen des zugeteilten Landes und dessen Verteilung an die einzelnen Siedler. Hierbei leitete er oftmals das Losverfahren oder teilte das Land möglichst gerecht zu, um Konfrontationen von Anfang an zu vermeiden. Außerdem stellte er Saatgut, Gerät und andere Arbeitsmaterialien zur Verfügung, die für die Siedlungsgründung, Urbarmachung (gerade bei der Ostsiedlung etwa die Trockenlegung sumpfigen Gebietes) und andere Aufgaben nötig waren. Auch Vorschüsse für Anschaffungen sowie den Lebensunterhalt für die Siedler in der Übergangszeit wurden meist vom Lokator getragen. Der Lokator war zudem der Stellvertreter für die Siedler, die er betreute.
- technischer Hintergrund
Beobachtungen von Bergen aus und Rauchzeichen als Orientierungspunkte waren Mittel, mit denen der Lokator das Land grob eingrenzte. Zur genaueren Abmessung der Siedlung wurden bei stark bewaldeten Gebieten Bäume angeritzt und in offenem Gelände das Areal mit einem Pflug eingegrenzt. Die Einteilung und Zuteilung der einzelnen Flurstücke für die Siedler erfolgte in der Landvermessung meist durch Messruten oder Messseile. Maßgrundlage war je nach Siedlung entweder die flämische Hufe (ca. 16 Hektar) oder die fränkische Hufe (ca. 24 Hektar).
Der Lokator nach Beendigung des Siedlungsbaus
Mit der Gründung einer Siedlung war die eigentliche Aufgabe eines Lokators erledigt. Wenn es sich um keinen professionellen Lokator handelte, der zur Gründung weiterer Siedlungen überging, blieb der Lokator am Gründungsort wohnen und nahm dort eine hervorgehobene Stellung ein.
- Wirtschaftlicher Hintergrund
Der Lokator erhielt meist mehr Land als die anderen Siedler und musste auf dieses im Gegensatz zu den anderen Siedlungsbewohnern keine oder nur sehr geringe Abgaben leisten. Außerdem unterstand ihm die Gerichtsbarkeit nach dem im Lokationsvertrag angewandten Recht, oft als sogenannter Lehnschulze.[4] Daraus erzielte Gebühren sowie Abgaben durfte der Lokator teilweise behalten (meist 1⁄3 der Summe, wobei 2⁄3 an den Landesherrn zu entrichten waren).
- Soziale Stellung, Rechte und Pflichten
Auch andere Begünstigungen, wie das Recht, ein Amt in der neuen Siedlung auszuüben (oft das des Schulzen) oder einer bestimmten Tätigkeit (Brauereiwesen/Ausschank) nachzugehen, waren Privilegien, die der Lokator genoss und die ihm zu Wohlstand und sozialem Aufstieg innerhalb der Siedlung verhalfen. Der Bau einer Mühle, in der die Siedler ihr Getreide mahlen lassen mussten, war ebenfalls oft dem Lokator gestattet und bedeutet hinsichtlich der dadurch anfallenden Gebühren eine zusätzliche Einnahmequelle, wobei der Großteil dieser Einnahme meist dem Grundherrn zustand. Außerdem wurden die entstandenen Siedlungen oftmals nach ihrem Lokator benannt. Beispiele hierfür gibt es zuhauf (Diedersdorf, Dittmannsdorf, Dittersbach, Petersheide, Heinersdorf u. a.). Oft zeigte der Siedlungsname auch an, woher die Siedler und der Lokator kamen (Frankenfelde, Flemmingen, Sachsenfeld, Schoobsdorf u. a.). Auch die Endungen der Ortsnamen sind deutliche Hinweise auf die Herkunft der damaligen Siedlungsbewohner.
- Alternative Vorgehensweise
Manche Lokatoren verkauften nach Fertigstellung der Siedlung ihre Rechte und Privilegien und betätigten sich andernorts wieder als Lokator. Hieraus resultierte eine vergleichsweise hohe Professionalisierung des Lokaturentums. Manche Lokatoren konnten daher als Berufslokatoren bezeichnet werden.
- Literatur
- Herbert Helbig (Hrsg.): Mittel- und Norddeutschland, Ostseeküste (= Urkunden und erzählende Quellen zur deutschen Ostsiedlung im Mittelalter. Band 1). Darmstadt 1975, ISBN 3-534-05960-3.
- Franz Kössler: Die Nachfahren des Lokators – zur Siedlungsgeschichte einer deutschsprachigen Landschaft im böhmisch-mährischen Raum. Hess, Bad Schussenried 2010, ISBN 978-3-87336-913-9.
- Paul Richard Kötzschke: Das Unternehmertum in der ostdeutschen Kolonisation des Mittelalters. Bautzen 1894 (Diss.).
- Josef Joachim Menzel: Der Beitrag der Urkundenwissenschaft zur Erforschung der deutschen Ostsiedlung am Beispiel Schlesiens. In: Walter Schlesinger (Hrsg.): Die deutsche Ostsiedlung des Mittelalters als Problem der europäischen Geschichte (= Reichenau-Vorträge 1970–1972). Sigmaringen 1975, S. 131–159.
- Weblinks
- Wiktionary: Lokator – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen
Veröffentlichungen im Opac der Regesta Imperii: zu locator, zu lokator.
Historische Wurzeln von Rövershagen
Am 25. März 1252 kaufte die Stadt Rostock vom Fürsten Borwin III. Die heutige Rostocker Heide. In den Folgejahren gründeten die Rostocker hier drei Dörfer: Rövershagen, Wasmodeshagen und Porikeshagen.
Am 17. März 1305 wird Rövershagen (22 Zinshufen) erstmals erwähnt, Wasmodeshagen (25 Zinshufen) dagegen erst 1310. Rövershagen muß schon 1305 eine ausgedehnte Ansiedlung, und von den drei genannten Ortschaften das Hauptdorf, gewesen sein, denn die Stadt gründete dort zwei Krüge, den einen an der Landstraße nach Ribnitz und den anderen im Dorfe selbst bei der neuen Kirche.
Daß sich die Rostocker damals lebhaft für die Gründung von Dörfern in den nordostwärts gelegenen Wald- und Heidedistrikten interessierten erhellt auch die 1311/12 niedergelegte Beschwerde des Königs Erik von Dänemark. Denn dort heißt es: „Sie (die Rostocker ) haben einen Teil unseres Ribnitzer Waldes niedergehauen, Ortschaften daselbst gebaut und dort lübisches Recht eingeführt, obgleich sie dies ohne unsern Willen nicht tun durften.“
Am 7. April 1325 erfolgt dann durch den Rostocker Rat eine dauernde Ordnung aller Verhältnisse in den drei Dörfern, die erkennen läßt, daß sie sich allmählich aus dem Walde heraus zu ansehnlichen Rodesiedlungen, sogenannten Hagen-Dörfern emporgearbeitet haben.
Rövershagen war bereits mit seiner Ersterwähnung am 17. März 1303 Hauptgemeinde und Zentrum des Kirchspiels der zur Hansestadt Rostock gehörigen "Heideorte".
1912 erfolgte die verwaltungsrechtliche Trennung der Heideorte Hinrichshagen, Markgrafenheide, Schnatermann, Wiethagen und Meyershausstelle, die unter der Bezeichnung "Heideortschaften" zu einer eigenständigen Verwaltungseinheit auf dem Rostocker Stadtgebiet wurden. Für Rövershagen und die verbliebenen Ortsteile Niederhagen, Oberhagen und Purkshof (6 1/2 Zinshufen), war damit die Loslösung vom Rostocker Stadtgebiet und Bildung einer eigenständigen Gemeinde außerhalb der Stadtgrenzen Rostocks verbunden. Die Selbstverwaltung war jedoch sehr eingeschränkt,da die Hansestadt Rostock zu großen Teilen Eigentümer des Grund und Bodens in Rövershagen blieb. Ihre geographische und historische Schlüsselfunktion trägt ihr den Beinamen "Tor zur Rostocker Heide" ein.
Chronologie zur Geschichte des Heidedorfes Rövershagen
Älteste Dorfansicht von Rövershagen auf der Lust´schen Reiterkarte von 1696 (Quelle: Archiv der Hansestadt Rostock)
Die Kürzel am jeweiligen Ereignis weisen auf deren Quellen hin:
BGSR = Beiträge zur Geschichte der Stadt Rostock
HK = "Heidechronik" Forstchronik von H.F. Becker und Georg Garthe 1839
BK = Kirchspielchronik von Rövershagen begonnen 1839 von H.F.Becker
FBK = aus der (anonymen) Fortsetzung von Beckers Kirchspielchronik
FK = Beckers Familienchronik von ihm 1786 bis zu seinem Tode 1852 geführt
AHR = Archiv der Hansestadt Rostock (oft mit Signatur folgend)
HE = Archiv Hans Erichson, Ribnitz
HA = Heidearchiv Wilfried Steinmüller
SC = Chronik von Dr. Wolfhard Strauch 2003 - 2005
Anmerkung: Bis 1912 gehörten alle Heideortschafen der städtisch Rostocker Heide zu Rövershagen. Die westliche Dorfgrenze Rövershagens hinter den Dünen der Ostseeküste befand sich beim Taterhörn zwischen Markgrafenheide und Warnemünde !!
spätes Mittelalter (um 1200 bis 1517)
- 1252, 25. März Borwin III., Fürst von Rostock, bestätigt der Stadt Rostock das Privilegium Borwin´s I. betreffend die Bewidmung der neu angelegten Stadt Rostock mit dem Lübischen Rechte vom 24. Juni 1218 und verkauft der Stadt die Rostocker Heide für 450 Mark wendischer Pfennige, verzichtet auf seine Rechte an den im Hafen der Rostocker gestrandeten Schiffen, verheißt den freien Verkehr vorbehaltlich des fürstlichen Zolles nicht zu stören, verleiht die Fischereigerechtigkeit für die Unterwarnow und das Stadtrecht für die Markscheide der Rostocker.
Damit wird das Gebiet auf dem Rövershagen gegründet wird Besitz der Stadt Rostock.
- 1305
- Urkundliche Ersterwähnung von Rövershagen im Rostocker Stadtbuch vom 17.März 1305 ( "Scriptum anno domini MCCCV° ante oculi" AHR)
- 1473
- 14. September Hans Klinkemann, wohnhaft zu Rövershagen, leistet der Stadt Rostock Urfehde wegen der Gefangenschaft, die er deshalb erlitten hat, weil er Holz aus der Rostocker Heide gestohlen hat. (AHR 1.0.1. U4 Gericht)
Reformation und Nachreformationszeit (1517 bis 1648)
- 1533
- Ernannte die Bürgerschaft Hans Beckentin zum Voigt über die Heide und Stadt Güter, und mußten die Schulzen ihm Gehorsam schwören. Allein auf Klagen des Halses ward er durch einen kaiserlichen Befehl von seiner Stelle wieder abgesetzt. (BK)
- 1570
- War Heinrich Brümmer Prediger zu Rövershagen, weitere Nachrichten fehlen. (BK)
- 1571
- Wurde der Magister Johann Grise von Langstorv in Pommern, zum Prediger nach Rövershagen berufen. (BK)
(Johann Griese führt während seiner gesamten Amtszeit ein chronikalisches Kirchenbuch über die Zeit von 1580-1605, das als ältestes Kirchenbuch Mecklenburgs gilt. W.Steinmüller)
- 1579
- Bei einem heimlichen Raub wird das Rövershäger Kirchensilber gestohlen. (BGSR VI 1912)
- 5. Juni Ratsbefehl: "Die Stadt-Bauern sollen auf Hochzeiten nicht mehr als 2 Tonnen Bier und auf Kösten nicht mehr als 6 Tonnen Bier ausschenken, und niemanden außerhalb des Dorfes zur Hochzeit bitten." (extractus protocollii anno 1579)
- 1605
- Ward Daniel Griese seinem Vater als Prediger substituiert. (BK)
- 1614
- den 7. Januar "sind 2 Bauern von Räubershagen (sic.!!!), Vater und Stiefsohn, vor dem Dorfe an einem dort neu errichteten Galgen Dieberey halber gehängt worden, welche eine lange Zeit allhier in der Stadtfrohnerei gefangen gehalten worden, endlich dahin geführet den andern Haid- und Holzdieben zum Schrecken und Spiegel aufs freie Feld gehänget...“ (AHR 1.4.17 – 250 LKR)
- 1625
- 10./11. Febr. war die bekannte schreckliche Überschwemmung zu Rostock und in der Umgegend, davon in dem Etwas von gelehrten Rostockschen Nachrichten 4.Jahrg. 898 i.J. 1740 eine ausführliche Nachricht abgedruckt sich findet.
- Zu hiesiger Gegend soll ein großer Theil der Waldung unter Wasser gestanden haben, ja es soll das Wasser in Niederungen bis Blankenhagen vorgedrungen seyn : Die Wasserhöhe des Maaßes war 14 Fuß über den mittlern Stand gestiegen (4,40m). Die Meierey auf dem Moorhof (vorh. Moor genannt) stand völlig im Wasser, Pferde und Ochsen ertranken, die Bewohner saßen 3 Tage im Dach auf dem Heu. Zu Warnemünde wurden von 150 dortigen Häusern 18 an der Düne gänzlich weggerissen und 74 stark beschädiget ; viele Schiffe zertrümmert. (BK)
Bis zur napoleonischen Zeit (bis 1813)
- 1647
- Am Ende des Dreißigjährigen Krieges werden von 37 Bauernstellen noch 15 Höfe bewirtschaftet. (SC)
- 1669
- Auf der Lustschen Reiterkarte sind noch alle Höfe des Hagendorfes dargestellt, während Hinrichshagen noch nicht orhanden ist.
- Ward der zu Markgrafenheide wohnende Jäger Brandt von einem Keiler erschlagen.Auf dem Heimwege nach der Kirche, wo er communicieren wollen, trifft er den Keiler und soll die ruchlosen Worte gesagt haben : Nach meiner Rückkehr soll dich oder mich der Teufel holen. Man fand ihn Abends todt mit aufgeschlitztem Bauch. Es ist ihm an dem Platz ein Kreutz errichtet und bis jetzt erhalten.(BK)
- 1671
- Kaufte das Kloster Ribnitz das verpfändete Gut Willershagen mit der Hölzung für 9000 Gulden. (BK)
- 1676
- Starb der hiesige Prediger Johann Georg Bindrim, er war 44 Jahre im Amte gewesen. (BK)
- 1677
- Ward Johann Harder aus Rostock hieselbst zum Prediger gewählt. (BK)
- 1702
- Überließ die Stadt dem Herzoge Friedrich Wilhelm die Jagd in der Heide auf Lebenszeit, und nahm sie alsdann wieder an sich. Herzog Carl Leopold wollte sie mit Gewalt an sich reißen und schickte einen Lieutenant mit 20 Dragonern nach Rövershagen um den Rostockern die Ausübung der Jagd zu wehren, ein kaiserl. Mandat vom 28. März 1714 inhibitierte diesen Gewaltstreich. (BK)
- 1703
- Alexander Joachim Scherping geboren zu Rostock 1677, ward in diesem Jahr dem hiesigen Pastor Harder substituiert. (BK)
- 1710
- Wurde der Hof Studthof, der an die Familie von Linstow verpfändet gewesen, von der Stadt zurückgenommen. (BK)
- 1712
- Starb der hiesige Pastor Johann Harder und sein Substitut Scherping ward als Prediger eingeführt.(BK)
- 1718
- Starb zu Purkshof der Pensionarius Hans Ströganz (?). (BK)
- 1723
- 26.Jul. starb der Heidevoigt Fried. Gottmann.
- Stürzte Christoph Melms von einem Baum und lebte nur noch einige Stunden. (BK)
- 1727
- Starb Benedir Plath, der 60 Jahre Küster hieselbst gewesen.
- Fiel Hinrich Kruse, ein alter Mann, beim Rückweg nach Hause, plötzlich todt nieder.(BK)
- 1731
- Bei der Schaffung der beiden Güter Oberhagen und Niederhagen (1743) werden 22 Rövershäger Bauernstellen gelegt. (SC)
- 1732
- Starb der hiesige Prediger Alexander Joachim Scherping. (BK)
- 1733
- Starb der Köster zu Jurshof Joachim Hinrich Hagen. (BK)
- 1734
- Ward der Cand. Christoph Gottlieb Stüdemann zum Prediger hieselbst erwählt und eingeführt. (BK)
- 1741
- 10.May - Verordnung daß die Bauernschaft zu Rövershagen ihr Korn nach hiesigen Mühlen-Damm zur Mühle fahren soll. (UA)
- 1746
- Starb der begehrte Küster Jacob Prehn. (BK)
- 1748
- Starb der Baumwärter Zimmermann. (BK)
- 1753
- Starb der Jäger Wramp. (BK)
- 1756 bis 1763
- währte der siebenjährige Krieg, wobei die hiesige Dorfschaft auch sehr gedrückt ward. (BK)
- 1760
- Unternahmen die Rostocker Kaufleute Jacob Johann Stypmann und Paul Grube eine große Torf Enterprise und ließen den Pramgraben vom Stinkengraben bis zum Breitling verfertigen. (BK)
- 1762
- Bildete sich das. erste Forstkollegium in Rostock, löste sich aber 1768 wieder auf, das Heidedepartement trat 1769 wieder an dessen Stelle. (BK)
- 1764
- Trat der Gewetts Secretair J.F.Möller seinen Dienst als Forstinspector an, er bekleidete ihn 16 Jahre. (BK)
- Seither ist Rövershagen Amtssitz des für die Rostocker Heide und die Heideortschaften zuständigen Forstinspektors. (WS)
- 1765
- Starb der Pächter zu Niederhagen Johann Cristian Hagemeister.
- Starb der Pächter zu Müggenburg Caspar Christoph Evert. (BK)
- 1766
- Wurde durch eine Commission, der Forst und des Amts Ribnitz, so wie der Stadt, die Grenze revidiert. Traf eine herzogliche Commission, worin der Oberforstinspektor Wulf den Vorsitz hatte hier ein um die Heide zu regulieren. Sie ließen ein Regulativ drucken, wogegen die Stadtbürger protestierten. (BK)
- 1767
- * Dienst- Bauer- und Wirthschaffts-Ordnung für das der Stadt Rostock gehörige Guth Rövershagen, Rostock, den 10. Mart. 1767 eingeführt, die lange normierte. (BK)
- 1768
- Starb der Jäger Hans Schulze (BK)
- 1770 Apr.
- starb der Wildfahrer Hans Borgwarth. (BK)
- 1770
- Litt die Dorfschaft von der Rindviehseuche. Im Febr. starb der Pächter zu Oberhagen Samuel Bringe, den 25. April starb der Prediger L.G.Stüdemann. (BK)
- 1771
- Ward der Magister Christoph Möller aus Rostock zum hiesigen Prediger gewählt.
- Starb der Jäger Johann Carl Wramp. Den 15.F. starb hieselbst der Kandidat der Theol.Samuel Grapengießer. (BK)
- 1772
- Ertrank der 10-jährige Sohn von Jacob Sour. (BK)
- 1773
- 13.Jan.starb der hiesige geachtete Prediger Mag. Christ. Möller. (BK)
- 1775
- Starb der Pächter zu Niederhagen Nicolaus Christian von Schröder Erbherr von Gut Nienhagen, die Leiche ward zu Alten Carin beigesetzt. (BK)
- Starb der Küster Hans Martin Eggert, 34 J.alt. (BK)
- Wurde Michel Peters begraben der 36 Jahre blind gewesen. (BK)
- 1776
- Brannte ein beträchtlicher Theil der Schwanberger Heide ab. (BK)
- 1777
- Starb der Pächter von Studthof und Jürshof Jacob Tesßin 93 ½ Jahre alt. (BK)
- Den 17.Sept wurde der Pächter von Purkshof Hinrich Plath 70 Jahre alt beerdigt. (BK)
- 1778 18.Nov.
- wehete zum Schaden der Forst ein starker Sturm. (BK)
- 1779
- Brannte der ganze Hof Purkshof ab.
- Im Mai erschoß sich der Jäger Fiede zu Haus als er mit einem geladenen Gewehr zwischen die sich beißenden Hunde schlug. (BK)
- 1780 15.Oct.
- erschoß sich der Forstinspector Möller mit einer Pistole, er wurde 52 Jahre alt und hatte manche Kränkungen und Unfälle erlitten. Er liegt unter der großen Linde des Kirchhofes.
- Im Jul. starb der Baumwärter Schnockel zu Haus. (BK)
- 1781
- Trat der Forstinspector J.Roedler seinen Dienst an. Er diente 10 Jahre und ward pensioniert. (BK)
- 1783
- Es ist zubemerken daß in 12 Monaten vom October 82 bis Oct.83 nur 2 Personen in diesem Kirchspiel gestorben sind.
- Im Apr. starb der Wildfahrer Claus Borgwarth 49 J. (BK)
- 1789
- Starb der Baumwärter Hans Lindemann 77 J. alt. (BK)
- 1791
- Legte der Forstinspector Rödler seinen Dienst nieder. 1.Juli ward der Forstinspector Herm. Fr. Becker zu Rövershagen eingeführt. Es waren dazu aus Rostock eingetroffen Sen.Dr. Prehn, Sen. Stange,Sen.Schrepp,K.Schroeder, K. Neuendorf,L.Altmann, L.Lober, Secret.Dethlof. (BK)
- 1792
- Wurde eine Hohe Scheune bei der Wroot gebaut.
- 21.Jul. schlug der Blitz in das Viehaus des Hofes Niederhagen. Es brannten das Viehaus die Scheune und das neugebaute Holländerhaus ab. Zeitgleich gab es 6 weitere Feuer in den benachbarten Dörfern. (BK)
- Ward Johann Hinrich Peters als Schulmeister zu Hinrichshagen angestellt.
- 11.-12.Dec. herrschte ein starker Sturm und deckte einen Katen in Hinrichshagen ab. (BK)
- Forstinspector Becker entwirft eine "Forstcharte, nebst Vorschlägen zur Verbesserung der Heide und deren Revenuen".
- 1793
- 3. März Warf ein heftiger Orcan die halbe, neuerbauete Scheune zu Niederhagen, sowie die Holzremise und ziemlich Holz in der Waldung um. (BK)
- 1795
- Forstinspector Becker entläßt seinen Rechnungsführer Babst wegen "Verdruß in den Geschäften".
- Starb der hies. Schulmeister Joh.Fried.Ahrens.
- Gab die Stadt, wegen hohen Getreidepreisen zu dem Schulgelde, welches von den Einwohnern zusammengebracht wird, 36 Thaler zu Hülfe. (BK)
- 1798
- Es wurden durch den Prediger Mag.Wehnert und den Forstinspector Becker Industrie-Schulen für Knaben und Mädchen angelegt, die Knaben erhielten Unterricht in Verfertigung allerlei Gerätschaften und die Mädchen in weiblichen Handarbeiten.Der Knaben Schule stand Schier vor und der Mädchen Schule die Tochter des Küsters Bartels.Es bestanden diese Schulen aber nur einige Jahre, weil es ihnen an Geld fehlte und die Stadt nichts beitragen wollte, indem die Bürger glaubten man werde Fuscher in ihren Handwerken bilden. (BK)
- 1799 8.Aug
- kam über den Schnatermann und den größten Teil des Dorfs ein Gewitter mit großem Hagel, unsere Feldfrüchte und Fensterscheiben zerschlug und großen Schaden anrichtete. (BK)
- 1800
- Wurde von dem Prediger, Forstinspector,den Pächtern, Bauern und Einliegern eine privat Armenanstalt errichtet, welche sich sehr nützlich erwies. (BK)
- Man fing an die Holzweide aufzuheben und das Vieh auf die Ackerweide zu verweisen. (BK)
- 1801 3.Nov.
- war ein heftiger Sturm der die Torfscheune umwarf. (BK)
- 1802 22.Januar
- starb der hiesige Prediger Mag.Christian Ludwig Wehner, er ward d. 25.Nov 1741 zu Güstrow geboren, d. 17.Sept. 1773 zum hiesigen Prediger gewählt. Er hatte die Zuneigung und Liebe der Gemeinde. Er fand seine letzte Ruhe unter der alten Friedhofs-Linde.
- 26.Oct. war im Dorf Einquartierung von rußischen Truppen auf eine Nacht. (BK)
- 1803
- Am Palmsonntag tritt der hier zum Prediger d.20. Jan. erwählte Cand.Christian Carl Wolf sein Amt mit einer rührenden Predigt an. (BK)
- 1805
- Starb der pensionierte Jäger Johann Joachim Schramm in Hinr. 77J. alt d. 12.Januar.
- D.5.Oct. starb im 63ten Jahre Johann Mattias Wramp. Pächter zu Studthof und Jürshof. (BK)
- Im Oktober und November ziehen 25 000 Mann russische und 12 000 Mann schwedische Truppen über die Heerstraße.
- 26. Oktober gab es in der Forstinspektion eine Einquartierung von 5 russischen Offizieren mit Bedienten. Auch der König von Schweden pausierte hier kurzzeitig. Der russische General, der auf dem Niederhäger Hof Hof logierte hieß Alexiew.
- 1806
- Entzündete ein Blitz das Holländerhaus zu Oberhagen ; welches eingeäschert ward.
- 30.Oct. starb der pensionierte Jäger Bauer 58 J.alt
- 24.Mai starb der hiesige Küster Herm. Fr. Bartels im 61.Jahr des Alters und 31ten des Amtes.
- Wurde der Hinrichshäger Schulmeister Johann Hinrich Peters zum Küster ernannt.
- Ward Friedrich Gramkow als Schullehrer in Hinrichshagen angestellt. (BK)
- 1806,
- Die Rövershäger flüchteten einige Tage nach Markgrafenheide, als das Schwarzsche Corps Angst und Schrecken verbreitete.
- 14.November - Eine Streifpartie Franzosen marodiert in den Dörfern entlang dem Landweg.
- 28. November Die Zeit der französischen Besatzung beginnt in Mecklenburg
- 1807
- In den ersten drei Monaten dauerten die Heerzüge der kaiserlich französischen Truppen nahe bei dem Dorf vorbei fort.
- starb der Schulmeister zu Studthof Johann Salomo Gerdes 74 J. alt.
- 22. Mai kamen der französische Gouverneur in Meckl. Laval und der Intendant Bremont nach Rövershagen und nahmen die Heide in Augenschein.
- 15.Sept.:Überstieg das Meer die Dühne und planierte sie. (BK)
- 11.-16.Oktober rückte eine Kompanie Fußsoldaten unter dem Kommando von Lieutenant Dumely zum Quartier ein.
- Besonders am 28.Oktober wurde eine Jagd gehalten, an welcher der Commandant von Rostock Colonel Lieutenant Maran, die Capitaine Nazal und Finguerlin,, die Lieutenants Crosh, Durye, und Marquis Bonneval hierher kamen und im Dorf logierten.
- 30.Oktober rückt eine Kompanie unter Anführung des Capitän Grineisen ein und blieben bis zum 26.November.
- 11.Oct. rückten die französischen Truppen unter Lieutenant Dumelie hier ins Quartier, ihnen folgten d. 30.Oct. andre unter Cap. Grineisen. (BK)
- 1808 Juni 13.
- starb der Praepositus emeritus Joachim Eenhardt Boecler, vieljähriger Prediger zu Sanitz im hiesigen Witwenhause.
- 3.Aug hatten wir Nachts ein starkes Gewitter, der Blitz schlug in einen Baum dicht an .....(?)
- 12./13.Aug und 8.Mai wurden die in der Heide angelegten Schneisen durch eine städtische Kommission mit Zuziehung vom Oberforstmeister v. Grävenitz und Forstinsp. Stave in Augenschein genommen.
- Fand sich ein Wolf im Walde an der mehrere Mastschweine zerriß. Er ward verfolgt aber entkahm. (BK)
- 1810
- am 30.August rückte der Capitain Marquelle und Lietenant Notte mit 33 Mann ein und blieben 13 Tage. Hierauf kam Lieutnant Pernot mit 14 Mann und blieb bis zum Ende des Jahres. Er mißbrauchte die Jagd.
- 1813, 11.(?) April
- Der Niederhäger Pächter Röper rüstet auf eigene Kosten einen Freiwilligen Jäger zu Fuß aus (Staudinger p.58)
Bis zur Reichseinigung (bis 1871)
- 1814
- ertrank des C.Aug. Waak Tochter 11 Jahr alt, auch wurden unsere Ochsen und Hunde toll.(BK)
- 1815 d.3.Februar
- starb der Holzwärter Albrecht Siegfried Petersen auf der Torfbrück 70 Jahr alt.
- Den 25.März starb der Holzwärter Carl Fried. Wramp zu Markgrafenheide 68 J. alt.
- Zog eine Wasserhose aus dem Meer bei Grahl vorbei längst der Heide biß Altenheide und Ribnitz, zerbrach eine Menge Bäume, warf andere nieder, und machte in der Gelbensander Forst eine Schneise eine starke halbe Meile lang und 24 Fuß (7 m) breit, in der Willershagner Heide stürzten 9 Bäume um. (BK)
- 1817 15.April
- starb der Jägermeister Joh.Hinrich Schäning 61J. Den 1.Jul. starb der Jäger Johann Jochim Adam Karsten zu Wiethagen 54 J.alt. (BK)
- 1818 14.Dec.
- machten die Fischländer Nachts mit vielen Böthen eine Invasion in die Heide und führten eine Parthie Holz aus dem Sack weg. (BK)
- 1820
- starb der pensionierte Holzwärter Johann Heinrich Kröger auf dem Schnatermann 113 Jahr alt. (BK)
- 1821
- Nahm der Cand. jetzt Professor Eduard Becker die Pachtung Oberhagen an. (BK)
- 1821 15.Dec.
- starb der Baumwärter zu Hinrichshagen Johann Jochen Hinrich Hinz 71 Jahre alt. Den 12.Apr. erhängte sich zu Jürgshof der Pächter(?)und Bürger aus Rostock Christian Wegener. (BK)
- 1822
- erschoß sich am 29.Dec. der Holzwärter Johann Christian Nicolaus Grälert zu Markgrafenheide 43 J.alt aus Unachtsamkeit als er mit einer geladenen vor sich gehaltenen Büchse die mit einander kämpfenden Hunde trennen wollte. (BK)
- 1823
- Kam der Einl.Claus Fried.Keding auf unglückliche Art ums Leben, indem die Pferde des Jag. Köhn die er führte nach einem Schuß davon liefen, er vom Wagen stürzte und die Hirnschale zerschlug.
- Den 13.Oct. starb der E.Heinrich Pragst durch einen Sturz vom Balken in der Scheune des Forstinspectors.
- Den 3.März starb der Jäger Carl Friedr. Köhn zu Hinr. 68 Jahr alt. (BK)
- 1825
- Hatten wir öfteren hohen Stand und Übertritt des Meeres über die Dühne am 4.Februar entstand beim Sturm aus Nordosten eine wahre Sturmflut, welche 300.000 Quadratruthen (650 ha) der Wiesen und des Waldes überschwemmte. Die Wasserhöhe war zu 6 Fuß 8 Zoll (1,95m) über den mittlern Stand des Meeres gestiegen, die Düne von der Fischerbude zu Markgr. bis an Rosenort 450 Ruthen (2100m) lang stand ganz unter Wasser, davon wurden 370 Ruthen ganz und 80 Ruthen halb planiert. Die Warnemünder fuhren mit Böthen auf die Wiesen.
- Es ward ein groß Holzmagazin zu Wiethagen erbauet. (BK)
- 1826
- In der Nacht vom 27. - 28.Aug. brannte durch ein Gewitter das Viehhaus zu Jörshof ab.
- Geriet das Dorf in größte Gefahr da fing bei starkem Winde der Flachs in und um den Backofen der Hebamme Hoff Feuer. (BK)
- 1827 15.März
- brannte der Hof Gragetopshof ab.
- Den 19.März starb der Wildfahrer Joh.Hinrich Borgwarth 59 J.alt. (BK)
- 1828
- 29.März starb der Schulmeister zu Studthof Johann Bernhard Gerts 63 J.alt; sein Nachfolger ward Jacob Hoff aus Rövershagen.
- Den 11.Aug. hatten wir ein Gewitter mit Hagel, der vorzüglich zu Oberhagen vielen Schaden anrichtete.
- Errichtete die Stadt eine eigene Deputation zur Bewirtschaftung der Eichen in der Heide. (BK)
- 1829, 11.Jan
- starb der Holzwärter aus dem Schnatermann Claus Kröger 63 J.alt.
- Den 19.Mai ersäufte sich der Fegermeister Claus Jacob Schüning 46 J.alt im Teiche ohnfern der Brücke zu Niederhagen rechts am Wege nach Hinrichshagen. Er hatte die Taschen voll Steine gesteckt und ward erst 14 Tage nachher gefunden. Er war dem Trunke ergeben. (BK)
- 1830
- Mit der Separation und Regulierung erfolgt in Mittelrövershagen die Festlegung der Grenzen für acht Bauernhöfe. (SC)
- 1831
- Den 2.März starb der Baumwärter Jacob Hinr. Peters zu Meiershausstelle. (BK)(Nicht an der Cholera!)
- Ab Mai wüthete die Cholera in Mecklenb. und Rostock, hier im Dorf starb nur ein Mensch daran.
- Forstinspektor Hermann Friedrich Becker regt den Bau einer Chaussee von Rostock nach Rövershagen an, um einen soliden Transportweg für das Heideholz in die Hansestadt zu bekommen. (HA)
- 1832
- Ward Johann Hinrich Peters seinem Vater als Küster adjungirt.
- Vom 5. - 6.Juli ertrank in der Ostsee der schwedische Matrose Peter Friedr. Holmström und ward hier beerdigt. (BK)
- 1833
- In diesem Jahr lösete sich das Heidedepartement auf und bildete sich das 2.Forstdepartement welches die Viraition (?) der Waldungen übernahm, wogegen das Cämmerey Collegium die Jurisdiktion und das Patronat erhielte.
- Fing die Regulierung der Stadt Waldungen an welche dem Oberförster Garthe zu Remplin und dem Forstinspector Becker hieselbst von E.E.Rath übertragen war.
- Ward der Cand.ernst Carl Fried. August Wolf dem Pastor Wolf, seinem Vater adjungiert und d.14.April ordiniert.
- Den Juli 27. starb der Jäger Friedrich Johann Dewitz zu Wiethagen 60 J.alt.
- Den 9.Sept.starb der Pächter Joachim Hopff (?) zu Niederhagen 78 J:alt. (BK)
- 1834
- Ward der Forstpracticand Georg Garthe dem Forstinspector Becker adjungiert. (BK)
- 1835 den 12.Aug.
- brannte des Hausmanns Wullenbäker Scheune zu Willershagen vom Blitz entzündet ab.
- Den 4.Sept zersprang des Jägers Köhn Gewehr auf der Hühnerjagd und zerschmetterte die linke Hand, welche abgenommen werden mußte.
- Den 27.März wurde die Leiche des im Meer ertrunkenen .....(?) Odebrecht ....(?) beerdigt. (BK)
- 1836
- Starb d.6.April der hiesige Prediger Christian Carl Wolf, geb.zu Rostock 13.Nov. 1761, zum Prediger gewählt d.20.Januar 1803. Er widmete in den 33 Jahren seiner Amtsführung seiner Gemeinde alle Kräfte und hatte sich allgemeine Liebe und Achtung erworben.
- Starb 31.Mai zu Niederhagen Christian Paetow, er war zum Besuch daselbst.
- Es lösete sich die Privat Armenkasse daselbst wieder auf und erhielte die Kirche vom Überschuß des Capitals 41 Thlr. 9 Schlg. (BK)
- 1837 4.Febr.
- starb der Jägermeister Daniel Heinrich Christian Clasen. Den 18.Jan.starb der Pächter zu Studthof Hartwig Kluth.
- Den 1.Juli ward dem Einl. Hinrich Keding 70 J.alt der Schädel von einem herabfallenden Zweige zerschlagen, er lebte noch 14 Tage.
- Den 7.u.8. Apr. fiel so viel Schnee, daß einige Gebäude bis zum Dach zugeschüttet waren.
- Den 29.Nov. wüthete ein Orkan. (BK)
- 1838 28.Nov.
- ging ein 4 Hiesch Kathen in Hinrichshagen in Feuer auf.
- Ward eine Theerschwelerey im Wiethäger Revier angelegt.
- Ward ein Canal vom Moorhof zum Pramgraben gezogen. (BK)
- 1839 den 12ten März
- stürzte der Benkenhäger Einlieger David Waak von einem hohen Baum beim Zapfenpflücken im Torfbrücker Revier und starb auf der Stelle. (BK)
- 1841
- War die Chaussee von Rostock nach Ribnitz im Bau begriffen, welcher 1842 beendiget ward.
- Am Johannis feierte der Forstinspector Becker hieselbst sein 50-jähriges Dienst- und Heiratsjubileum, jedoch ganz in der Stille. Er erhielt von Serenissimo das Diplom als Forstmeister und von der Akademie das Diplom als Doctor philosophiae. Seinem Adjunkten dem Forstinspector Garthe (Georg) wurden die Geschäfte überwiesen, jener jedoch behielt sein volles Gehalt.
- Den 1.-8ten September war die Versammlung Teutscher Land- und Forstleute in Doberan. (BK)
- 1843
- Im December brannte der halbe Hof Haeschendorf ab. (BK)
- 1843/44
- Der Krug "Stadt Rostock" an der Chaussee Rostock-Ribnitz wird gebaut. (WS)
- 1844 den 27ten Juni
- ward ein Student, namens Mühlenbruch, Sohn des Besitzers von Gerdeshagen, zu Roevershagen auf dem Kirchhofe mit Glockengeläut begraben. er war mit einem Studenten Wolters aus Hamburg im Sturm in die Ostsee gesegelt, das Boot umgeschlagen und beide, sowie der Matrose, der sie gefahren hatte, waren ertrunken, Mühlenbruch am Rosenort, Wolters aber zum Fischland ans Land getrieben und dieser dort beerdigt.
- In diesem Jahre ward vom Forstmeister Becker eine Leihbibliothek für die Dorfbewohner hieselbst errichtet, deren Aufsicht der Prediger und der Forstinspector Garthe übernahmen und die vom Küster Peters administriert wird. (BK) :(erste öffentliche Leihbibliothek Mecklenburgs)
- 1845
- Polier war Zimmergesell Hoff. Gedeckt ist der Thurm vom Thurmdeckermeister Schultz zu Rostock erbaut. Der Riß dazu ward von dem Stadtbaumeister (?) ausgeführt. (sic. BK)
- 1846
- Der jetzige Rövershäger Kirchturm ward im Sommer 1846 von Schweder (?) und dem Zimmermeister Mahn in Rostock angefertigt und von dem letzteren ausgeführt. Bürgermeister waren damals in Rostock Kaufmann Bauer, Doctor Bencard und Doctor Petersen, Aeltester beim ersten Quartier Kaufmann Paetow und beim zweiten Schuster-Aeltester Seeger. Patronen der Roevershäger Kirche waren Senator Ziel und Doctor Weber, Prediger in Roevershagen E.Wolff, Kirchenvorsteher Bauer Hoff in Mittelhagen, Bauer Suhr in Oberhagen und Bauer Koopmann in Mittelhagen, Küster Peters senior und Peters junior (Adjunkt) Forstinspectoren waren der Forstmeister Becker, welcher aber schon zwischen Ostern und Johannis nach Rostock zog und der Forstinspector Garthe, Pächter in Niederhagen Ch.Hopp, in Oberhagen Pippow, in Stuthof C.Viethaack und in Purkshof Lewerentz, Schultze war der Bauer Hoff in Oberhagen. (BK)
- 1852 5. Oktober
- Der langjährig verdienstvoll für Rövershagen und die Rostocker Heide wirkende Forstinspektor Hermann Friedrich Becker in Rostock verstorben.
- 1856
- Am Ende des Monats September brannte in Hinrichshagen das Jägerhaus und 2 Katen, worin im ganzen 11 Familien wohnten, ab.
- Im Juli schlug der Blitz in die Pappel, welche am Steige vor dem Witwenhause stand. (BK)
- 1857, 6.Juli
- Grundsteinlegung für die neue Forstinspektion. (HK)
- 1858
- Heu war in diesem Jahre hier bei uns im allgemeinen auch wohl nicht viel mehr, als im vergangenen Jahre. Das Winterkorn dagegen war ziemlich gut, das Sommerkorn sogar sehr gut gewachsen. Das Winterkorn hatte in einem Teil von Mittelhagen und in ganz Oberhagen sehr durch den Hagel gelitten, welcher am 12ten Juli fiel und noch viel mehr ‘Schaden gethan haben würde, wenn nicht der Wind ganz still gewesen wäre. (FBK)
- 1859
- Am 11ten Juli feiert der Forstinspektor Garthe hieselbst sein fünfundzwanzigjähriges Jubiläum, eingedenk danken sämtliche Jäger und Baumwärter mit einem silbernen Pokal und von den Mitgliedern des Forstdepartements wurde ihm ein Patent des Großherzogs überreicht, enthaltend die Ernennung desselben zum Forstmeister.
- Am 17ten August schlug der Blitz in das Witwenhaus, welches abbrannte und nicht wieder aufgebaut ward. (FBK)
- 1862
- Am 24ten November
- empfingen wir zu unserer silbernen Hochzeit aus der Gemeinde ein Geschenk von 12 silbernen Eßlöffeln und 12 silbernen Teelöffeln. (FBK)
- 1863
- In der Nacht vom 22 auf den 23ten December war ein solcher Sturm, daß in der Rostocker Heide ungefähr 26 bis 30 000 Bäume umgestürzt sind. (FBK)
Deutsches Reich bis 1918
- 1877
- Juni Beisetzung des am 26. Juni verstorbenen Oberforstmeister Georg Garthe unter der großen Linde vor dem Turm der Kirche (LKR)
- 1889
- Mit der Eröffnung der Eisenbahnstrecke Rostock-Stralsund erhält Rövershagen eine Bahnstation (SC)
- 1892
- Richard Suhr in Rövershagen geboren. (Er wird später ein bekannter Volkskundler und Mitbegründer des Museums in Ribnitz.) (HE)
- 1897
- 1. Oktober Oberforstinspector Julius Garthe verstorben, findet unter der großen Linde vor dem Turm der Kirche seine letzte Ruhe. (LKR)
- 1898
- Auf Befehl Sr.Hoheit des Herzoges Johann Albrecht vom 2.April 1898 soll eine an dem 1.Januar 1898 beginnende Chronik eines jeden Kirchspiels eingerichtet und weiter geführt werden.
- Es ist nur eine Kirche vorhanden. Der von Holz 1846 erbaute Thurm ist so schadhaft geworden, daß die Bauausführung eines steinernen Thurmes vom Patronat in Aussicht genommen ist.
- Das läuten mit der großen Glocke hat eingestellt werden müßen, weil Gefahr vorhanden ist, daß diese Glocke aus dem Lager rutscht und dadurch große Gefahr für den Glockenläuter herbeigeführt werden möge. Man begnügt sich, mit dem Klöppel anzuschlagen. Die kleine Glocke ist seit dem 28.April 1887 gerißen und seit der Zeil durchaus unbrauchbar. Vom Patronate ist wiederholt der Umguß oder die Reparatur dieser Glocke erbeten, dasselbe behandelte die Sache in der ...... .(?) Die Wiederherstellung dieser Glocke soll nun zugleich mit der Erbauung des Thurmes vorgenommen werden.
- Schulhäuser sind 3 vorhanden in der Gemeinde: in Mittelhagen, in Hinrichshagen, in Stuthof. Das Mittelhäger Schulhaus ist nach einer an demselben befindlichen Einritzung im Jahre 1816 erbaut worden. Jetziger Küster und Lehrer ist Karl ........(?) eines Lehrers Sohn aus ......(?) bei Stavenhagen. Seine Personalien u. Familie of. Familienhandbuch pag.330
- Das Schulhaus zu Hinrichshagen scheint ein alter Bau zu sein. Lehrer ist Christoph Rong aus Lützow, des Kantors Rong an der dortigen reformierten Kirche. Er ist zur lutherischen Kirche übergetreten. Seine Personalien p.205
Das Schulhaus in Stuthoff ist ein erbärmlicher alter Katen. Die Schulstube ist vor einer Reihe von Jahren in den Nachbarkaten hinzugebaut, so daß dadurch eine Stube für den Lehrer gewonnen ist.
- Lehrer in Studthoff ist Ludwig Klatt, eines Schmiedes Sohn in Wittenburg. Seine Personalien d. Familie of. pag.109 im Familienstandsbuch.
- Die Schulhäuser sind noch sämtlich mit Stroh gedeckt.- Das Pfarrhaus ist 1870 neu gebaut, als Ludwig Dolberg Pastor war, der im 70. Jahr 1875 entsetzt wurde.
- Jetziger Pastor ist Christian Schultze, Sohn des Pastors Schultze in Goldberg. Er war vorher Pastor in Jessenitz u. hieselbst gewählt 1875. Dom.p.Trin..XXI.17.Ort. Er erhielt 118 Stimmen. Sein Gegner Pastor Albrecht in Penzlin (später in Recknitz) 5 Stimmen. hinzugeführt wurde. (FBK)
- 1898
- Pastor Schultze durch den Superint. Schwane (?) aus Doberan 1875. Dom.p.Trin.XXYI.Nov.21.
- Seine Antrittspredigt hielt er sodann anno Dom. adv. III. Sein Umzug hierher war sehr kostspielig, u. weil böses Scneewetter eingetreten war, sehr mühselig. - Persönliches in Walter "Unsere Landesgeistlichen" und Familienstandsbrief p.254. (FBK)
- Die Zahl der Gemeindeglieder war Mich.1898 = 8 Hauswirthe, Wullenbäker ...(?),Crull, der Schulze,Heinr.Hoff .....(?) Kienzmann,.....(?)
- i.J. Hoff verhandelte lebhaft über ihre Vererbpachtung, welche der Magistrat zu Rostock ihm nicht zuweisen will.
- - Die Gutspächter sind: Ernst Malchin zu Oberhagen, Personalien Famil.b.p. 421.
- - Wilhelm Stichert in Niederhagen p.340.
- - Friedrich Stichert p.419 zu Stuthof; ein Pächterhof v. Rost. Jürgenshof Gustav Strömann p.266, ein aus der Magdeburger Gegend zugewanderter Landwirth.
- - Forstinspektor ist Max Garthe seit 1898. Geborn ist derselbe hierselbst 1864 Juni. -Sein Vater, dem er vorher adjungiert war, war der hiesige Oberforstmeister Julius Garthe, welcher hier am 9.Oct. 1897 starb. (FBK)
- Im Jahre 1898 wurden die beiden Kämmereisenatoren Brömann, ein Pächter zu Captow, und Rögner, ein Landmeister, zugleich krank u. dienstunfähig. Sie hatten die Kirchenrechnungssachen vertrödelt schon seit Jahren. Die Interimistischen Patrone P.J.L. Bursand, Bürgermeister in Laage, und Blaetz ein Rechtsgutachter, holten die Rechnungs....? hieselbst nach, und zwar am 14.Febr. die Jahrgänge 1889 bis 1894 und am 15. März die von 1895 bis 1897. (FBK)
- Am 14.Juli wurde hier die Synode abgehalten.(FBK)
- Am 16.Juli wurde im Küsterhause eine ....? unter dem Patronate abgehalten wegen Anlegung eines .....? auf dem Küstereigehöfte. Derselbe wurde danach auch durch den ....? Niemann in Rostock hergestellt, hart an der Vorstraße mit einem Zaune umgeben.(FBK)
- 1898
- Am 21.August.D.p.Tr.XI hielt der Superint.Pentz aus Doberan hier eine plötzliche Inspection ab. Er traf den Pastor nicht zu Hause, der Küster las die Predigt. Der Pastor predigte in Volkenshagen, was dem Sup. genügend angezeigt war. Das Resultat der Inspection ist in einem Schreiben des Superint. Penz vom 28.Aug bei den Akten. -
- Am 5.Oct.wurde ein Herbstsepardt ? im Gasthof zum "Fürsten Blücher" in Rostock abgehalten. (FBK)
- Am 20.Nov.Dom.p.Trin.XXN. Kircheninspection durch den Superint. Penz. Er hielt eine Ansprache über Ps.CXXI s.2. -Darauf Conferenz mit den Lehrern im Pfarrhause. Der Pastor fand nicht viel Freude in den Augen des Herrn Superintendenten. Die Predigt des Pastors war ihm nicht klar genug. Er mußte über den vorgeschriebenen Text Matth.XXII,23 - 33 predigen. - Am 21.August wurden die drei Schulen inspiciert. (FBK)
- 1899
- Am 1.März war der Pastor zum Präpositus nach Toitenwinkel geladen, um mit ihm zusammen eine Erzieherin zu prüfen. -
- Am 11.April wurde in der Schule durch den Pastor das vom Herzog- Regenten Johann Albrecht als Zeichen der Anerkennung der Schule geschenkte Bildnis des Großherzoges Friedrich übergeben. - Die Schriften dazu bei den Akten. -
- Von Pfingsten bis D.p.Trin.X ist der Pastor schwer erkrankt gewesen, so daß er sich alle 14 Tage durch Prädikanden hat vertreten und Taufen und eine Beerdigung durch die Amtsbrüder in Bentwisch, Volkenshagen und Blankenhagen hat verrichten lassen müssen. - Am D.p.Tr.XI hat er wieder angefangen zu predigen. (FBK)
- 1900
- Laut Vertrag vom 25./30. Januar, der am 6.Febr.d.J. die oberheitliche Bestätigung erhalten, ist nun ein Teil des der hiesigen Pfarre zu liefernden Holzdeputates abgelöst, nämlich
- 41 rm Eichenknüppelholz (3M pro rm)
- 2 rm Buchenkluftholz (5M a rm)
- 11 rm Kiefernkluftholz (4 M a rm)
- 11 rm Ellernkluft (4 M a rm)
- Es wurden dafür dem jeweiligen Pastor im Johannistermin jedesmal je 221 Mark ausgezahlt.
- Es verbleiben der Pfarre:
- 45 rm Buchen, die weiter in natura geliefert werden und
- 10 rm Kiefernkluft von den Gütern Niederhagen (55 rm)
- 10 rm Ellernkluft und Oberhagen (10 rm) anzuliefern sind. (FBK)
- Im Frühling wurde der alte, im Jahre 1846 erbaute Holzturm abgebrochen. An seiner Stelle wurde ein neuer, massiver Turm aufgeführt, der am 13. Juli gerichtet werden konnte.
- Die seit dem Jahre 1887 gerissene kleine Glocke wurde, nachdem sie umgegossen war, am 13. Sonnt.vor Trin. vom Pastor durch Geleut am Gottesdienst eingeweiht. (FBK)
- 1901
- Im Januar wird der nunmehr vollendete neue Turm und die durch neuen Anstrich geschmückte Kirche der Gemeinde vom Patronat zur Benutzung übergeben, nachdem solange interimistisch im Schulhause Gottesdienst abgehalten war. (FBK)
- 1902
- Am 23. Mai stirbt nach langer Krankheit der Pastor Christian Schultze im Alter von fast 66 Jahren, der seit Dezb. 1875 in hiesiger Gemeinde das Pfarramt verwaltet hat. (FBK)
- Mit der Aufwartung während des Gnadenjahres, das übrigens vom Patronat bis zum 1.Juli 1903 verlängert wird, wird der Pastor Haefke - Volkenshagen beauftragt. (FBK)
- Von Mitte Juni bis Mitte August wird das Schulhaus in Hinrichshagen durchgebaut. Der Schulunterricht, der wegen des Baues in der Schulstube nicht erteilt werden kann, wird in das Wiethäger Samenhaus verlegt. (FBK)
- 1903
- Am 26. April folgt Gertrud Schultze, Tochter des Pastors Schultze, noch auf dem Sterbebett konfirmiert, ihrem im Tod vorangegangenen Vater im Tode nach, eben 14 Jahre alt. (FBK)
- Am Sonntag Invocavit, d.1.März, findet die Wahl eines neuen Pastors statt. Es sind der Gemeine zur freien Wahl präsentiert:
- Rektor Werner - Gadebusch
- Pastor Borgwardt - Rechlin
- Konrektor Ritter - Ludwigslust.
- Bei der Wahl, die altem Herkömmen gemäß vom Patronat geleitet wird, erhält von 141 abgegebenen Stimmen Rektor Werner 105, Borgwardt 13, Ritter 23 Stimmen. Werner ist somit mit großer Stimmenmehrheit gewählt. Den sogenannten Honoratioren der Gemeinde sagt der gewählte Pastor nicht zu, und schon gleich nach der Wahl wird darauf hingearbeitet, die Wahl Werners rückgängig zu machen. Man wirft ihm unerlaubte Wahlumtriebe vor. Die von ihm selbst, mehr aber noch von seinen Angehörigen und Verwandten ins Werk gesetzt sein sollen. Er soll auch in seiner Wahlpredigt in unerlaubter Weise für seine Person geworben haben. Wie viel Wahres an diesen Beschuldigungen ist, kann der Berichterstatter nicht beurteilen. Jedenfalls. Jedenfalls ist dem Rektor Werner vom Oberkirchenrat nahe gelegt worden, zurückzutreten, was dieser dann auch getan hat. - Über diesen Ausgang der Pfarrerwahl bricht bei den kleinen Leuten helle Empörung aus. Sie wollen, wie sie sagen, "ihren, von ihnen ordnungsgemäß gewählten Pastor haben und keinen anderen". Die Empörung und Unzufriedenheit in der Gemeinde wird von bestimmter Seite her gehörig geschürt, teilweise in widerwärtiger Weise, und wächst immer mehr. Selbst die bevorstehende Reichstagswahl wird benutzt, um die Unzufriedenheit zu schüren. Ein liberaler Wahlredner hält auf dem Rövershäger Krug eine Wahlrede über "Reichstagswahl und Pfarrerwahl". In der Lübecker Eisenbahnzeitung erscheint ein Artikel über die `Ritterwahl in Ränkeshausen´, der in glühenden Parolen das den kleinen Leuten in der Rövershäger Gemeinde geschehene Unrecht schildert. Kein Wunder, wenn diese erklären, sie würden bei einer neuen Kirchenwahl einfach nicht in der Kirche erscheinen. Von dieser Drohung haben sie aber wohlweislich keinen Gebrauch gemacht. Die neue Wahl wird vom Patronat auf den Sonntag Rogate d.7. Mai, angesetzt. Diesmal wurden der Gemeinde präsentiert:
- Rektor Wegner - Doberan
- Rektor Iaacks - Warin
- Rektor Schultz - Neustadt.
- Es wurden 107 Stimmen abgegeben, wovon Wegner 3, Iaacks 30, Schultz 74 Stimmen erhält. Damit ist Schultz gewählt. Dieser wird am 1.Sonnt. post Trin. durch den Superintendenten Dr.Behm introduzirt. er hält zugleich seine Antrittspredigt über Luk. 16.19-31. das Evangelium des betr. Sonntages. Anfang Juli siedelt Schultz von Neustadt hierher über und hält am 5.Sonnt.p.Trin.,also am Bettag vor der Ernte, seine erste unter den fortlaufenden Predigten.
- Die verwitwete Pastorin Schultze zieht nach Gehlsdorf. Die Kämmerei hat ihr 450 Mark Mietsentschädigung zugebilligt.
- Um Weihnachten herum wird eine Hauskollekte für ein in Schwerin zu erbauendes Männersiechenhaus in der Gemeinde abgehalten. Nach Abzug der Unkosten kann als Ertrag der Kollekte 81,10 M abgeschickt werden.
- Bei Gelegenheit der Pfarrbaukonferenz bittet der Pastor das Patronat um Schenkung eines neuen Altar-Kruzifixes. Das alte war beim Durchbau der Kirche und Neubau des Turmes zerbrochen worden. - Anfangs Dezember teilt das Patronat mit, daß es 100 Mark zur Anschaffung eines Kruzifixes zur Verfügung stelle. Pastor besorgt ein solches von der Kunstanstalt der Berliner Stadtmission. Das Kruzifix, Ebenholz mit echtem versilbertem Bronzeträger, trifft am 23. Decb. hier ein und dient zum ersten Mal am Weihnachtsfest als neuer, schöner Schmuck der Kirche. (FBK)
- 1904
- Schon wärend der ganzen zweiten Hälfte des Jahres 1903 waren wegen Vererbpachtung der hiesigen Pfarrländereien an die Stadt Rostock Verhandlungen geschlagen zwischen Pastor, Kämmerei und Oberkirchen-rat. Der Kämmerei liegt sehr daran, den Pfarracker zu erwerben, weil die hiesigen Hauswirte vererbpachtet werden sollen und nach ihrer Vererbpachtung nicht mehr nötig haben, die Kühe der Forstarbeiter und desd Küsters, wie bisher, auf ihre Weide zu nehmen. Die Kämmerei ist somit genötigt, einen Weideplatz für diese Kühe zu schaffen. dazu liegt ihr der Pfarracker sehr bequem, der schon lange Jahre hindurch nicht bestellt worden ist, sondern immer als Weide für des Pastors Kühe gedient hat. Der Oberkirchenrat ist bereit, die Vererbpachtung gegen einen von 10 zu 10 oder von 20 zu 20 Jahren neu zu regelnden Kanon zu genehmigen. Auch der Pastor erklärt sich bereit.. Da er aber den in der Nähe des Waschhauses außerhalb des Gartens liegenden Teich nicht entbehren kann, (zum Zweck der Wäsche und des Begießens durchaus notwendig!) stellt er die Bedingung, daß der Teich und etwa 400 Quadratruten des ihn umgebenden Ackers zum Garten geschlagen werden, und daß der ganze Garten, incl. des Reservats, das der Pfarre verbleiben soll, und das bisher als Standkoppel gedient hat, mit einem haltbaren, sicheren Drahtzaun umgeben werde. Die Erfüllung dieser Bedingungen wird zugesagt. - Nachdem die eben erwähnten 20 Ruten (Teich und umgebendes Land), außerdem noch 80 Ruten, die zur Erweiterung der anno 1888 errichteten Pfarrhäuslerei dienen sollen, vom Pfarracker abgetrennt sind, soll nunmehr im Sommer in einer Schlußsitzung über die Vererbpachtung der noch verbleibenden 5110 Ruten Ackers verhandelt werden, ebenso über die Vererbpachtung der zur Pfarre gehörigen Wiesen. In dieser Sitzung, die in der Kämmerei zu Rostock stattfindet, erklärt der Vertreter der Kämmerei plötzlich, die Stadt Rostock sehe von einer Vererbpachtung der Pfarrländereien ab, sie wolle dieselben vielmehr gegen Erlegung eines einmaligen Kaufpreises erwerben. der Superintendent ist, - trotz der Einsprüche des Pastors - sofort bereit, den Verkauf der Pfarrländereien beim Oberkirchenrat zu befürworten, und der Oberkirchenrat erklärt sich auch - trotz aller bösen Erfahrungen bei Verkäufen von Pfarrlande wie in früheren Zeiten - damit einverstanden, daß die Pfarrländereien gegen ein Kaufgeld in den Besitz der Stadt Rostock übergehen - für immer!! Als Kaufpreis werden 20685,43 Mark vereinbart. Dieser Preis ist in der Art berechnet, daß für die 5110 Quadratruten Acker 511 Mark ( 10 Pfennige pro Rute!) für die Wiesen 213 Mark, im ganzen also 724 Mark in Ansatz gebracht sind. Diese 724 Mark als Zinsen gedacht, ergeben das Kapital von 20685,43 Mark ( das Nähere hierzu siehe in den Akten über die Pfarrländereien!)Der Kaufvertrag ist unter dem 15./23.Septb.1904 abgeschlossen und am 24.Oktober 1904 oberbischöflich bestätigt worden. Die aus dem Kaufpreis aufkommenden Zinsen stehen dem jeweiligen Pastor zu, jedoch nicht in vollem Umfang. Der Pastor muß vielmehr ein Fünftel dieser Zinsen als für die Pfarre zu kapitalisierenden Betrag abgeben. So bildet sich mit dem Jahre 1904 ein Pfarrfonds, der sich von Jahr zu Jahr um 1/5 jener Zinsen vergrößern wird. Die Verwaltung dieses Fonds steht dem Pastor zu, der aber dem Superintendenten alljährlich bis zum vorgeschriebenen Termin darüber Rechnung abzulegen hat. Mit dem Verkauf der Pfarrländereien hängt zusammen eine Änderung betr. die von den Hauswirten zu leistenden Anfuhr von 4 Fuhren Heu. Die Hauswirte haben sich bereiterklärt, für diese 4 Fuhren (a 6 Mark) jährlich an den Pastor 24 Mark, jeder 3 Mark, zu zahlen. Diese 24 Mark sollen immer zusammen mit dem Michaelisopfer eingesammelt werden. Die Hauswirte haben in die Pfarre 12 Scheffel Roggen, 36 Sch.Gerste und 48 Sch. Hafer = Rostocker Maß = zu liefern (§ 22.1a des Rövershäger Dorfkontraktes !). Für dieses Korn hat die Kämmerei seit langen Jahren den Hauswirten den entsprechenden Geldbetrag bezahlt, und zwar nach Martinipreisen. Die Kämmerei ließ den Schulzen das Geld zukommen, der es dann unter die übrigen Hauswirte verteilte. Die Hauswirte aber gaben zum größten Teile nicht das Geld an den Pastor, sondern lieferten ihm das Korn in oft recht minderwertiger Qualität in natura. Der Pastor ist, da er ja keine Wirtschaft mehr hat und haben kann, deshalb bei der Kämmerei darum übereingekommen, daß diese den bisher an die Hauswirte bezahlten Geldbetrag direkt an ihn auszahlen. Die Kämmerei war dem nicht entgegen, und so ist denn die der Pfarre von den Hauswirten zustehende Kornlieferung von jährlich 12 Sch.Roggen, 36 Sch.Gerste u.48 Sch.Hafer vertragsmäßig für immer in eine Geldzahlung, die nach Martinipreisen von der Kämmerei an den Pastor zu leisten ist, umgewandelt. Dieser Vertrag ist unter d.24.Januar 1904 oberbischöflich bestätigt worden. (s.Akten!) (FBK)
- 1904
- Ostern, ist der Lehrer Klatt aus Stuthof in das neuerbaute Schulhaus zu Niederhagen eingewiesen worden. Die Schule in Stuthof geht ein, dafür ist in Niederhagen eine Schule errichtet worden. Die neue Schulstube ist ein für ca. 48 Schüler genügender Raum, sehr hell und luftig, mit praktischen neuen Schulbänken und Schultischen ausgestattet. Das freundliche Schulhaus entspricht allen Anforderungen, die man an ein solches stellen kann. Bei der Verlegung der Schule von Stuthof nach Niederhagen vernotwendigt sich eine neue Verteilung der Schulkinder aus den einzelnen Ortschaften.
- Es wurden zugewiesen der Schule zu Niederhagen: die Kinder aus Niederhagen, Stuthof, Jürgshof und die Kinder vom Westende Rövershagens (Taubenberg, Forstgehöft, Hufe I, Wildfahrer und die dort liegenden Katen)
- Die Schule in Hinrichshagen giebt ab die Kinder von Niederhagen und erhält dafür diejenigen aus Wiethagen.
- Die Schule in Rövershagen, behält aber diejenigen von Purkshof und Oberhagen.
- Im Laufe des Sommers 1904 wird das Pfarrhaus einem langwierigen Durchbau unterworfen. Die Ständer oben sind zum großen Teil bereits vergangen, und das Dach ist schadhaft geworden. So wird den der ganze obere Teil des Hauses abgerissen und erneuert und das ganze Haus mit einem neuen Schieferdach versehen. Das Pfarrhaus hat durch diese Änderung sehr gewonnen, um so mehr, als noch einige neue Stuben hinzugekommen sind und ein ordentlicher Rauchboden, der bisher fehlte, geschaffen ist.
- Im Novbr.hat d. Pastor das der Pfarre gebliebene Reservat (bisher Stadtkoppel) auf seine Kosten rigolen lassen (60-70 cm tief) und den ganzen Ort mit Obst bepflanzt, und zwar zum größten Teil mit Apfelzwergbäumen, gleichfalls auf eigene Kosten. Vorher ist dieses Stück Land, da es zu naß war, abdräniert. Die Drains hat die Kämmerei geliefert, die Ausgaben an Tagelohn hat der Pastor zu tragen. Bei dieser Gelegenheit ist auch der alte Garten der Länge nach, vom Waschhause bis zum Graben an der Nordseite, durch einen Strang drainiert worden. (FBK)
- 1905
- Im Frühling des Jahres 1905 ist um den ganzen Garten, incl. Reservat, der versprochene Drahtzaun errichtet worden. Die Pfähle sind eichen, also auf lange Zeit haltbar. Der Draht ist ziemlich dichtmaschig und bietet deshalb sicheren Schutz gegen etwa eindringende Hasen und dgl.
- Im Laufe des Jahres ist mancherlei zum Schmuck der Kirche angeschafft worden. Am 31. Aug. traf eine neue vom mecklenburgischen Posamenten- verein angefertigte Altarbekleidung, sowie eine neue Altarpult- und Kanzelpultdecke ein. Alles ist aus grünem Tuch angefertigt. Altarbehang und Kanzeldecke sind mit Goldstickereien versehen. Letzteres enthält das Monogramm ....Die Altardecke zeigt vorn ein goldgesticktes Kreuz mit der Umschrift: Lasset uns ihn lieben, denn er hat uns erst geliebt. Das gleichfalls neu angeschaffte leinene Altartuch enthält den rotgestickten Spruch: Das Blut Jesu Christi muß uns rein von aller Sünde. Nachträglich wurden noch Schutztücher von gemeinem Leinen beim Posamentenverein bestellt, die im Oktober geliefert wurden. Die Kosten für den Altar- und Kanzelschmuck sowie für die Schutztücher wurden aus den angesammelten `milden Gaben´bestritten. Da uns für den Altar- und Kanzelschmuck nur ca.100 Mark zur Verfügung standen, kam der Pastor beim Vorstand des Posamentenvereins ein um Ermäßigung der kosten, die in entgegenkommender Weise gewährt wurde. der ganze Kanzel- und Altarschmuck hat nur 100 Mark, die Schutztücher 20 Mark gekostet. Im Oktober ist aus der Kirchenkasse ein Opferteller aus poliertem Messing, versilbert, angeschafft worden, auch von der Kunstanstalt der Berliner Stadtmission bezogen worden ist. (FBK)
- 1906
- Auf Anregung des Pastors und nach langen diesbezüglichen Verhandlungen mit der Kämmerei wird Ostern 1906 in allen drei Schulen der Gemeinde Handarbeitsunterricht eingeführt, der für alle Mädchen, wenn sie 8 Jahre alt sind, obligatorisch ist. Als Lehrerinnen für diesen Unterricht, der in 6 Stunden wöchentlich erteilt werden soll, wurden gewonnen : die frau des Lehrers Hansen für die Schule in Rövershagen, die Frau des Lehrers Rong für Hinrichshagen und für die Schule in Niederhagen die unverehelichte Näherin Marie Papenhagen in Niederhagen. alle drei legten, um den Nachweis ihrer Fähigkeit zur Erteilung des Industrieunterrichtes zu erbringen, eine Prüfung in Neukloster ab, die von allen bestanden wurde.
- Im Laufe des Sommers wird das alte Strohdach des Küsterhauses abgerissen und statt dessen dem Küsterhause eine Bedachung von Zementziegeln gegeben. Bei dem zu diesem Zweck nötigen Durchbau werden oben zugleich 2 neue Stuben hergerichtet, eine am Südgiebel des Hauses, die andere vorn über der Haustür.
- Am 23. November wird die zur Pfarre gehörige Scheune an der Westseite des Teiches, da sie nach dem Verkauf der Pfarrländereien überflüssig geworden ist, auf Abbruch verkauft, und zwar für 241 Mark. Diese Summe wird dem Pfarrfonds zugelegt. Die Zinsen von den 241 Mark stehen ohne Abzug dem jeweiligen Pfarrer zu. (FBK)
- 1907
- Von Ostern 1907 ab dürfen die Kinder vom Westende des Dorfes Rövershagen, die seit Ostern 1904 der Schule in Niederhagen zugewiesen waren, wieder, wie seit alters her und wie nur billig, die Schule in Rövershagen besuchen. Da durch diesen Zuwachs die hiesige Schule überfüllt wird, wird bis auf weiteres in dieser Halbtagsunterricht erteilt. Dadurch entstehen zwei Klassen. Zur zweiten Klasse, der unteren Stufe, gehören drei Jahrgänge; die übrigen 5 Jahrgänge werden der ersten Klasse, der Oberstufe zugewiesen. Die Oberstufe hat durchweg am Vormittag, die Unterstufe am Nachmittag Unterricht. (näheres darüber je in den Schulakten und Stundenplänen!) (FBK)
- 1908
- Mit dem 1.Januar 1908 tritt nach Verfügung des Oberkirchenamts vom 12.Sept 1907 eine neue Ordnung für Begräbnisgebühren in Kraft. Es ist fortan zu zahlen:
- 1) für Erwachsene (über 15 Jahre) ohne Rede = 5,18 M, mit Rede = 6,35 M
- 2)für Kinder zwischen 6 Wochen und 15 Jahren ohne Rede = 3,00 M; mit Rede = 4,17 M
- 3)für totgeborene Kinder und Kinder unter 6 Wochen, nach einfachem Ritus = Nicht, wenn Pastor Rede hält = 1,17 M
- 4)für Leichen anderwärts nahmhafter, aber in der Gemeinde Rövershagen gestorbener und auch auswärts beerdigter Personen sind nur dann Gebühren zu zahlen, wenn kirchliche Funktionen in Anspruch genommen wurden.
- 5)Für auswärts nahmhafte u. gestorbene Leichen, die hierher zur Beerdigung überführt werden, bleiben, wie bisher, die dergestalten Gebühren von Bestand.
- Die der Kirche, dem Pastor und dem Küster durch diese Neuregulierung entstehenden Einbußen sollen aus dem Kirchenfonds ersetzt werden, und zwar
der Kirche mit 2,35 M jährlich, dem Pastor mit 5,15 M jährlich, dem Küster mit 1,78 M jährlich.
- Um Johannis ist in der Gemeinde eine Hauskollekte zum Besten des Gotteskastens abgehalten werden. Es konnten nach Abzug der Unkosten 75 Mark eingeschickt werden.
- Im Sommer wurde an der Nord- und Westseite des Friedhofes, soweit derselbe hier nicht eingefriedigt war, ein weiß gestrichener Lattenzaun errichtet, der sehr zur Verschönerung des Friedhofes beiträgt und ihn zugleich schützt gegen das Eindringen von Kühen und anderen Tieren. Dem Wohlwollen und Entgegenkommen des Patronats ist es zu danken, daß der Altarraum der Kirche erheblich verschönert ist, indem die Schranken um den Altar sowie das um diesen liegende Kniekissen erneuert, die Schnitzereien des Altaraufsatzes neu gemalt, bzw neu vergoldet worden sind unter Aufwendung erheblicher Kosten. Dadurch hat die ganze kirche unendlich gewonnen, und der freundliche Eindruck, den die hiesige Kirche auf jeden macht, der in sie eintritt, ist dadurch noch wesentlich erhöht worden.
- Im Herbst ist die in Graal-Müritz neu erbaute Kirche eingeweiht worden in Gegenwart des Großherzoges und der Großherzogin. Der neu entstandenen Gemeinde Graal-Müritz ist auch Torfbrücke und das Torfbrücker Waldhaus zugeteilt worden, die bis dahin zur hiesigen Gemeinde gehörten. Die aus Torfbrücke und Waldhaus eingehenden Gebühren, besond. das Michaelisopfer, stehen, so lange der jetzige Rövershäger Pastor im Amt ist, diesem zu. Fürderhin ist es den Einwohnern von Torfbrücke und Waldhaus gestattet, in Rövershagen taufen und beerdigen zu lassen etc., so lange die Amtsdauer des jetzigen Pastors währt. (FBK)
- 1909
- Im Waldhause wohnte seit mehreren Jahren schon bloß noch eine Familie. Am Ostern 1909 ist auch diese fortgezogen. Seitdem steht das Waldhaus leer und soll, weil sehr baufällig, dazu sowieso im Walde gelegen, nicht mehr bewohnt werden, sondern über kurz oder lang abgebrochen werden. Dafür ist vor einigen Jahren bereits ein neuer dritter Forstarbeiterkaten in Torfbrücke gebaut worden, der von 4 Familien bewohnt wird. Im Sommer ist die Süd- und die Ostseite der Kirche mit mit selbstklimmendem Wein (Ampelopsis Veitchii und Ampel.Engelmanii) bepflanzt, wodurch, wenn der Herr Gedeihen giebt, auch das Äußere des Gotteshauses sehr gewinnen wird.
- Am 15.November starb, 61 Jahre alt, die Witwe Auguste Marie Dorothea Peters, geb Borgwardt, Ehefrau des anno 1882 gestorbenen hiesigen Küsters Johann Carl Adolf Peters. Sie war seit der Zeit ihrer Ehe hier, wo sie den lange schwerkranken Mann zu pflegen hatte, eine rechte Kreuzträgerin gewesen und ist ihr Leben lang eine solche geblieben. Zumal in den letzten Jahren hat sie selber an schwerer Krankheit zu tragen gehabt, treu gepflegt von ihrer Tochter Marie, der Frau des jetzigen Lehrers und Küsters Hansen. (mit Bleistift kaum leserliche Anmerk.:gest 1952...?)
- Um Weihnachten wurde in der Gemeinde eine Hauskollekte abgehalten zum Besten der Mission in Deutsch-Ostafrika. Diese Kollekte brachte netto die Summe von 70 Mark. (FBK)
- 1910
- Der Pastor bittet die Kämmerei, sie möge ihm für seine Amtszeit das der Pfarre noch zustehende Deputatholz (s.1900!) nicht in natura verabfolgen lassen, sondern ihm den dafür ausgesetzten Betrag von 381,25 Mark auszahlen. (Dieser Preis ist seit vielen Jahren schon von der Kämmereikasse an die Forstkasse bezahlt worden.) Kämmerei erklärt sich bereit, die Bitte des Pastors zu erfüllen, behält sich aber vor, die betr. Verfügung zurückzunehmen, "wenn dazu ein Anlaß gegeben ist." Das betr. Deputatholz ist von den Gütern Niederhagen (55 rm) und Oberhagen (10 rm) anzufahren. Die freie Anfuhr wird dem Pastor mit 65 Mark berechnet. Das Gut Oberhagen verpflichtet sich zur Zahlung von 10 Mark, das Gut Niederhagen zur Zahlung von 45 Mark pro anno an den Pastor, so lange dieser auf die Anfuhr des Holzes verzichtet.
- Mit Johannis 1910 beginnt für das Gut Niederhagen eine neue Pachtperiode. Pächter bleibt der bisherige Pächter Wilh.Stichert: Auf ein entsprechendes Antrag des Pastors an die Kämmerei ist in den Pachtkontrakt die Bestimmung aufgenommen, daß, so lange die jetzige Pachtperiode dauert, alle Abgaben des Gutes Niederhagen an die Pfarre in Geld zu zahlen sind. Dabei sollen für Eier, Kaff u.s.w. die Preise gelten, die in den `Grundsätzen für die Veranschlagung von Pflanzen´(Regierungsbl.1906, No.5) festgesetzt sind, das Korn soll nach der höchsten Rostocker Notiz des Michaelistages bezahlt werden.
- Seit vielen Jahren nicht sind so wenige Geburten in der Gemeinde Rövershagen gewesen wie in dem Kirchenjahr 1909/1910 (16!). Selten sind aber auch so wenige Todesfälle vorgekommen wie in diesem Jahr. Es sind nur 6 Personen beerdigt, und unter diesen 6 war noch ein totgeborenes Kind und eine Leiche, die von Wandsbeck hierher gebracht war zur Beerdigung. (FBK)
- 1912, 13.3.
- Die Rostocker Bürgerschaft beschließt die Abtrennung der "Heideortschaften" von Rövershagen
- 17.4. Schaffung einer eigenen Schulzenstelle für Rövershagen (AHR 1.4.17 Sig.251/1)
Deutsches Reich bis 1945
- 1922
- Gebietsstreitigkeiten zwischen Rövershagen und der Hansestadt Rostock um die zu Rövershagen gehörende Enklave am Taterhörn zwischen Hohe Düne und Markgrafenheide. (AHR)
- 1924
- Die Hansestadt Rostock als Eigentümer der Liegenschaften wandelt sieben der acht bestehenden Zeitpachtbauernstellen in Erbpachthöfe um. (SC)
- 1944
- Errichtung eines Frauenkonzentrationslagers in Oberhagen (SC)
SBZ und DDR bis 1990
- 1946
- Auf Grund des Zustroms von Flüchtlingen und Vertriebenen verdoppelt sich die Zahl der Rövershäger Einwohner auf mehr als 1000 Bewohner. (SC)
- 1952'
- Gründung des Staatlichen Forstwirtschaftsbetriebes Rostock mit Sitz in Rövershagen. (SC)
- 1958
- Auf der Grundlage enteigneter und aufgegebener Bauernhöfe wird nach mehreren Zwischenstationen das Volkseigene gut (VEG) Rövershagen gegründet.(SC)
- 1971
- Eröffnung eines neuen Schulgebäudes der Polytechnischen Oberschule Rövershagen mit 8 Klassen und 4 Fachräumen. (SC)
- 1973
- Rund 1100 Fichten lieferte der Forstwirtschaftsbetrieb Rövershagen Ende November an den VEB Schiffsversorgung Rostock. Die mit Wurzeln ausgegrabenen Bäume gingen mit Schiffen auf die Reise, die zu Weihnachten auf hoher See oder im Ausland sind. Ferner liefrte der Forstbetrieb Anfang Dezember noch 40 000 Weihnachtsbäume, die in der Rostrocker Heide, auf dem Darß sowie in der Nähe von Barth und Marlow geschlagen wurden. (UM 12/1973)
- 1974, 1.8.
- Die Pfarrstelle Volkenshagen wird stillgelegt, Volkenshagen mit Mönchshagen und Vogtshagen werden der Rövershäger Kirchgemeinde angegliedert.
- 1979
- Einweihung eines Landambulatoriums im Gebäude der einstigen Molkerei. (SC)
- 1985
- Eröffnung einer neuen Kaufhalle. (SC)
die heutige Zeit
- 1994
- Übergabe eines neuen Gebäudes für das Gymnasium und Baubeginn neuer Wohnviertel in Rövershagen. (SC)
- 1998'
- Der Gemeinde Rövershagen wird ein eigenes Wappen verliehen. (SC)
- 2002
- Einweihung dere Kindertagesstätte "Heidehummeln". (SC)
- 2018 22.11.
- Die freiwillige Feuerwehr erhält ein neues Mehrzweckfahrzeug
- 2018 26.11.
- Feuerwehr-Großeinsatz, Auf einem Feld nahe Purkshof verbrennt eine Strohmiete mit 500 Ballen
* Bedeutende Bewohner des Dorfes Rövershagen
"Rövershäger Geschichte(n)
Die Gerichtslinde
(Text: Wilfried Steinmüller)
- Als im 13.Jahrhundert die neuen deutschen Siedler, von weit westlich der Elbe, vorrangig aus dem westfälischen Weserbergland zwischen Hameln und Holzminden, hier ihre neue Heimat schufen, brachten sie nicht nur die Siedlungsform des Hagen-Dorfes (Waldrodungsdorf) mit.
- Sie hatten im Gepäck auch den "Sachsenspiegel", das mittelalterliche niederdeutsche Rechtsbuch.
- Wie so häufig in unserem Küstenlandstrich, rodeten sie auch an diesem Ort zunächst den Wald auf einer Größe von 12 Bauern-Hufen, darüber hinaus eine dreizehnte Hufe (Doppelhufe) als zukünftigen Kirchenbesitz und vorgesehenen Standort für das Gotteshaus und den Gottesacker.
- Noch vor dem eigentlichen Kirchenbau pflanzte man neben dem vorgesehenen Bauplatz der Kirche sodann eine (Gerichts-) Linde.
- Unter Anwendung des mitgebrachten Niedergerichts-Buches, eben dem Sachsenspiegel hielt man am Ort fortan unter freiem Himmel ("unter dem Auge Gottes") Gericht.
- Noch in den 1980er Jahren stand hier an diesem Standort die inzwischen ausgesprochen stattliche, sehr umfangreiche, viele Menschen-Generationen alte Linde und repräsentierte damit über Jahrhunderte hinweg das Zentrum des Dorfes als Vermächtnis seiner Gründer.
- Der Rövershäger Stellmacher Robert Millberg berichtet aus den 1950er Jahren, daß er das Innere der sehr vitalen Linde entmulmt, und sie anschließend ausgemauert habe.
- Für das 18. und 19. Jahrhundert dokumentiert, war es über Generationen Tradition daß langjährige Seelsorger der Gemeinde und leitende Forstbeamte unter der Linde ihre letzte Ruhe fanden.
- Dokumentiert sind unter ihnen der verdientsvolle Pastor Wehnert, Pastor Wolff sowie die Forstinspektoren Johann Friedrich Möller, Georg, Julius und Paul Garthe und deren Familienmitglieder.
- Auszüge aus dem Heidelberger "Sachsenspiegel" um 1300
1310-1378 Das verschwundene Dorf Wasmodeshagen
- (KFC RH Rövershagen RO 37-011 folgend)
1523 Hundediebstahl am Heidekrug
In den Erinnerungen des Stralsunder Bürgermeisters Bartholomäus Sastrow, geschrieben in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts, findet sich folgende Geschichte: Nikolaus Smiterlow, der Sohn des Greifswalder Bürgermeisters Bertram Smiterlow, dazumal 27 Jahre alt, war für seinen nichtsnutzigen Charakter bekannt. Als er einmal nach Rostock reisen wollte und in Rövershagen zur Nacht blieb, kehrten im dortigen Krug auch einige Kaufleute ein. Einer von ihnen führte einen Jagdhund mit sich , der dem Smiterlow ins Auge stach. Als der Hund in den Krug lief, wurde er von dem Nichtsnutz ergriffen und heimlich festgebunden, um ihn zu behalten. Als die Kaufleute am Morgen aufbrechen wollten, vermißten sie den Hund. Nachdem sie das ganze Haus abgesucht hatten, fanden sie ihn bei Smiterlow und forderten ihn zurück. Davon ungerührt wollte der sein Pferd besteigen und mit dem Hund an der Leine davonreiten. Als der Kaufmann ihm in die Zügel griff, zückte Nikloaus das Zündrohr und wollte iihn erschießen. Nach einem heftigen Handgemenge entriß der Eigenthümer des Hundes dem Smiterlow die Waffe und schoß ihm in den Schenkel. Den Hund zurücklassend, floh der Reiter zu Pferd in Richtung Rostock. Trotz der alsbaldigen Behandlung durch den Wundarzt war er kurz darauf des Todes. Der Kaufmann aber ritt seines Weges.
- ( HG 04 )
1573 Dem Pfarrer arg mitgespielt
Als der Rövershäger Pfarrer am Sonntag, dem 5. Juli 1573, auf der Kanzel predigte, drang ein Trupp Reiter des damaligen Herzogs Johann Albrecht in das Pastorenhaus ein, raubte seine Bücher, Speck und Inventar. Anschließend brachen sie die Kirchentür auf, holten den Pfarrer von der Kanzel, mißhandelten und verspotteten ihn. Zuletzt nahmen sie mit Gewalt des Pastors Frau mit, die man später entehrt und mit durchschnittenem Hals fand. Die alarmierten Rostocker sandten den Reitern alsbald einen Trupp bewaffneter Knechte und Reiter nach. Einige Tage hatten die Suchtrupps die Heidedörfer durchstöbert, und es zeigte sich bald, daß ih Ehmkenhagen, am Südzipfel der Heide, eine Abteilunh herzoglicher Heckenschützen unter dem Befehl des Hauptmanns Leonhardt Siebdraht und des Rittmeisters Günthersberg Quartier bezogen hatte. Am Morgen des 7. Juli gegen 3.00 Uhr riß ein Trupp von 300 Rostocker Kriegsknechten die bezechten Marodeure aus dem Schlaf, und es kam zum Gefecht. Die Rostocker führten viele Gefangene weg, die beiden Hauptleute aber flohen in den Schutz der Stadt Ribnitz.
- ( HG 09 )
Anm.: Bei dem Pastor müßte es sich dem Datum nach um Johann Grise gehandelt haben, obwohl die vorangegangenen im Ordelbok des Rostocker Niedergerichts festgehaltenen Ereignisse in Grises Aufzeichnungen keine Erwähnung finden.
1584 Die Hexe Trina Benckens
Aus Rostocker Niedergerichtsakten übertragen
"19. August 1584. Trina Benckens bekandt, wen sie ein geböthet, darauf ›unsteden‹ gewesen, so spreche sie: Drei möteden, drey böteden, der ein ist der vatter, der ander ist der sohn, der dritte wer der heilig geist. Wenn sie den Kindern den halß gezogen, so hette sie gesagt: Nein stich stedeloß, nein kindt vaderloß, sondern der heilig Cerst allein. Wenn sie den lebendigen wurm gebötet, so hette sie gesagt: der wurme sind 9, den blaen und grawen, den ecken, den stecken, den kellen, den schwellen, den riden, den spliten, den lopen und rondenden, du schalt dith blueth nicht suegen, diße knaken nicht gnaen, die sehnen nicht thanen, dein angel schal in diesem fleische stilstahn alß ich hab in mutterleib gestahn, und hette drumb geschlagen zehr und knobbelock. Wenn sie den zagen wegk gewiset, so hette sie gesagt: Diß fleischk solstu nicht bißen, diese knaken solstu nicht gnagen, dein munth sol stil sthan alß Christus am creutze stundt; und wen ers im munde gehebt, so hette sie gesagt: Die hillige viff wunden segen dir das alß aus dem munde. Auf Blocksberg sei sie auf einem Ziegenbock geritten mit den Worten: auf und davon und nergens an, auf und der nedder, umb der dritten stundt hir wedder. Auf dem Berge wäre ein Teich, drin stunde mitten ein roth mummelcken bloth, und wenn man das herauskriegen könnte, ›so muste der düfel drauf kein thunt mehr haben‹. Sie hätten nach der lulcken pfeiffe getanzt. Ferner habe sie den Satan gebadet, dazu Wasser gegen den Strom gefüllt, er sah aus wie ein Kind, der eine Fuß wie ein Gänsefuß, der andre wie eine Ochsenklaue, an den Händen hatte er Krowel. Einem habe sie ein goeth vor die Thür gegossen, ihm dann aber wieder gebötet und hatte gesagt: der gennig, der die es gethan, der benehm es dir wieder in der düfel nahmen und führe es in abgrundt der hellen. – Be- kandt, das sie Meister Clauessen dem zimmerman zugesagt, er solte bei seinem dienste zu Warnemünde wol pleiben, und sie hette ihm derenthalben gelehret, das er des morgens die hende waschen solte und sagen: Ich nehme wasser auf meine hende: Gott und die ware werde hillig lichnam kome my zu hulpe an meinem lesten ende. ich sach blöden 3 gesellen in allen seinen wapen, das alle meine viende schlapen und wesen doff und blindt. Solchs hette sie ihm wol vor 1/2 stige Ihar geleret, und er hette ihr wol ein par kannen bier davor gegeben. – Bekandt, das ein edelman ungefer vor 6 jaren zu sie gekommen und rath bei sie gesucht, das er verdorrete und verquene, den ehr hette ein krügersche verdacht, das ihm solchs angethan, den ehr ihr tochter beschlapen; do hette dies weib gesagt: Die Krügersche hette erde auß seinem fuethsparen genommen und in den Ramen gehenget und gedroget, nun solte ehr wieder erde nehmen auß der Krügerschen fuethsporen in aller † namen und in den rock hengen, so soltes dem weib bestahn und ihm vorgahn, davor hette ihr der eddelman gegeben 21 sch. lbs. Bekandt, das sie Hans Sauren zum Roverßhagen im Uberhagen, wen man nach Ribnitz zicht an die lincke handt, den pferden die füße gewaschen auf den donnerstag in aller düfel nahmen, das dieselbigen wieder gedien solten, die Quaiar hetten ihr das wasser gebracht, darnach hette Hans Saure das wasser bei einen dorenbuschk gegossen, die davon verdorret bei dem Sekenhause. – Sie habe einem Pferd, ›so twerschlaget gewesen‹, mit einem neuen Besen über den Leib gefegt, in aller † namen, und es wäre wieder aufgestanden. – Sie habe den Pferden Salz und Brod übergeworfen und den Satanas davon in Abgrund der Hellen gewiesen. – Endlich, das sie Peter Lüchten ein Poth zugerichtet, den er unter den sül vor der hußthür gegraben, das er guden dege krigen und sein broth wol verkeuffen solte."
- ( NHG 02 )
1593 - 1821 Die "Schweinevorsteher" - zwischen "Bürgerschweinen" und "fremden Schweinen"
Ab 1675 taucht in Rövershäger Akten immer wieder der Begriff "Vorsteher" im Zusammenhang mit der dortigen Schweinehaltung auf. Vier mit diesem Amt versehene Rövershäger Bauern hatten zu beurteilen, wieviel Schweine zur Eichen- und Buchenmast jährlich in die Heide getrieben werden durften. Der Ertrag an Eicheln und Bucheckern war ehr verschieden. Manunterschied nach dem Gelde, daas der Besitzer an die Stadt Rostock zu zahlen hatte, zwischen Bürgerschweinen und fremden Schweine. Den Bürgern von Rostock, deren Weidegeld bedeutend niedriger war, als das der fürstlichen oder ritterschaftlichen Untertanen, waren die Bauern der Stadtdörfer gleichgestellt. Freischweine, für die kein Mastgeld bezahlt werden brauchte, hatten die Bürgermeister der Stadt Rostock, die Pfarrer an den vie Hauptkirchen, der Schreiber des Gewetts. Das Gewett war die Behörde, der die Rostocker Heide und die Stadtdörfer unterstanden. Freischweine hatten weiter die beiden Heidevögte (je 2), der Schulze von Rövershagen (3), die vier Bauern, denen die Beaufsichtigung der Mast oblag (je 1), vier Hirten (je 2) und der Pastor von Rövershagen (5 Schweine). Lange Register über die Einnahme an Mastgeld liegen im Rostocker Archiv und zeigen, daß in guten Jahren auchSchweine von jenseits der Warnow in die Mast getrieben wurden. Heute ist nklar, wie man aus diesen hunderten von Schweinen am Ende die eigenen wieder herausfand. Mit einer einfachen Kerbe im Ohr war es da wohl nicht getan. Erst im Jahre 1821 wurde die Schweinemast auf betreiben des Forstinspektors Becker in den Waldungen der Rostocker Heide endgültig abgeschafft.
1791 - 1844 Industrieschule und erste Dorfbibliothek Mecklenburgs
Im Jahre 1791 übernimmt der bis heute berühmte Forstmann Hermann Friedrich Becker die Verwaltung der Rostocker Forsten als Forstinspektor in Rövershagen. Die Zustände in diesem Dorf beschreibt er damals so:
- „Es gibt in diesem Ort 25 Einliegerfamilien. Sie hausen in langen Strohdachkaten. Diese Katen stecken voller Menschen, jede Einliegerfamilie hat ein ganzes oder halbes Dutzend Kinder. Die Bettelei ist in den letzten Jahren zu einer wahren Landplage geworden. Die Dorfschaft wurde von Landstreichern geplagt wie der Hund von Flöhen.“
- Senator Dr. Schröder, enger Freund Beckers, hatte für die Hansestadt Rostock eine Armenordnung durchgesetzt und eine private Armenanstalt eingerichtet. Die Landstreicher kamen ins Werkhaus und mußten ihr Brot verdienen. Wer den Bettlern fortan etwas gab, machte sich strafbar.
- Der Rövershäger Forstinspektor eiferte ihm nunmehr auf dem Lande nach, gründete eine ländliche Armenanstalt und ließ bei jeder Bettelei drastisch eingreifen.
- In der folgenden Zeit lauerten dem Forstmann wiederholt Landstreicher auf, die sich für die Verfolgungen rächen wollten, aber Becker als guter Schütze vermochte es stets, sich ihrer zu erwehren.
- Im Jahre 1798 verbündete er sich mit dem Pastor des Ortes und richtete zwei Industrieschulen ein. In seinem schriftlichen Nachlaß findet sich dazu folgende Bemerkung:
- „Aber ich versuche, den armen Leuten auf meine Art zu helfen, sie herauszureißen aus ihrem Stumpfsinn. Was tun die Männer nach Feierabend? Sie rauchen schlechten Tobak, verpesten damit die Luft der engen Stube und schlafen ein. Mit den Frauen und Mädchen ist es nicht viel besser. Kaum eine versteht einen guten Faden zu spinnen. Sie machen es so wie ihre Mutter, die es auch nicht verstand.
- Da habe ich nun für die armen Rövershäger Kinder zwei Industrieschulen eingerichtet, eine für Knaben, welche im Flechten und Holzpantoffel machen, später auch in der Leineweberei und Holzschnitzerei unterwiesen werden, und eine für Mädchen, denen man das Nähen, Stricken und Spinnen beibringt.
- Ich habe mir das zum Muster genommen, was im Halleschen Waisenhause erprobt wird und was kürzlich ein gewisser Pestalozzi in der Schweiz eingerichtet hat.“
- Jahre später, 1844, richtete der bereits pensionierte Becker in Rövershagen die erste öffentliche Dorfbibliothek Mecklenburgs ein.
- Beim Rostocker Rat erntete er dafür nur wenig Verständnis.“
- ( HG 87 )
1806 - 1813 Franzosenzeit in Rövershagen
- "Das Dorf hat in der Franzosenzeit auch sehr stark herhalten müssen. Mitunter mit sehr viel Einquartierung belegt und großen Sorgen wegen der Verpflegung ausgesetzt. Ein großer Trupp Franzosen hatte hier lange Zeit Quartier. Auf der Hufe Nr.5 lag ein Oberst in Quartier. Hinter dem Garten von dieser Hufe war Dreesch, zu Hufe 6 gehörend, und wurde benutzt als Truppenübungsplatz. Hufe 7 hatte eine große Stube, und sie benutzten die Franzosen als Tanzlokal. Es wurde sehr viel getanzt.
- ( NHG )
- Verschmähte Speise
- In einer Kammer dieser Hufe hatte ein Kompagnie-Schuster seine Arbeitsstelle. Dieser Mensch war nie mit seinem Essen zufrieden. Mein Urgroßvater (Claus Jacob Suhr) war damals Besitzer und beschwerte sich bei dem Oberst auf Hufe 5. Er sagte zu ihm er müsse ihm den Schuster abnehmen, denn der Mensch sei mit nichts zufrieden. Das Fleisch, welches sowieso schon knapp sei, werfe er aus dem Fenster. Der Hund passe schon immer auf, um es aufzufressen. Wenn ihm dieser Mensch nicht abgenommen würde, so könnte eines Tages etwas passieren, ganz gleich, welche Folgen es nachher geben würde. Der Schuster bleibt, auch geht das Fleisch den gewohnten Gang. Mein Urgroßvater, ein vierschrötiger Mann, langt sich den Schuster her und haut ihn windelweich. Der Schuster wird ihm abgenommen, ohne nachteilige Folgen. Auf der Hufe 3 war ein Hauptmann in Quartiere. Der damalige Besitzer hat ein sehr hübsches Pferd, daß sich gut reiten läßt. Der Hauptmann benutzt es sehr viel. Eines Tages will er wieder reiten, und der Knecht führt ihm ein anderes Pferd vor. Der Franzose ist mißtrauisch und sagt: "Ist es sicher, sonst nimm dich in acht." Der Knecht sagt: "Es geht gut! Der Ritt beginnt, das Pferd zeigt sich guter Laune, aber nur kurze Zeit, und der Reiter liegt am Boden. Der Knecht, der wußte, wie es kommen würde, ist in den Wald verschwunden.
- ( NHG )
- Vergebliche Werbung
- Auf dem Gute Niederhagen, das zu Rövershagen gehört, lag auch ein Oberst. Daselbst warf ein junger, ganz gewandter Knecht, den der Oberst gern als Burschen haben wollte. Der Knecht hatte aber keine Lust. Eines guten Tages verhandelt der Oberst wieder mit ihm und will ihn mit Gewalt zwingen. Der Knecht läuft weg. :Der Oberst hat ihn fast erreicht. Einen großen Graben, der in den Wald geht, benutzt der Knecht und springt immer hin- und herüber. Auf diese Art und Weise erreicht der Knecht einen kleinen Vorsprung und gewinnt den Wald mit einer kleinen Anhöhe. Der Oberst gibt sein Spiel noch nicht verloren, steigt vom Pferd und verhandelt wiedere: "Werde mein Bursche, du sollst es gut bei mir haben." Der Knecht zeigt sich schon etwas zugänglicher, und der Oberst denkt er habe gewonnen. Aber zu früh. Der Oberst klettert die Anhöhe hinauf, und die günstige Gelegenheit benutzend, greift der Knecht in seinen Busen, wo er ein kleines Handbeil versteckt hatte, und schlägt den Oberst vor den Kopf. Der Knecht namens Bröckert, ist gerettet, verschwindet im Wald. Der Oberst ist betäubt.
- ( NHG )
- 1809 Der Zug nach Stralsund
- Gleich nachdem sind die Franzosen abgerückt nach Stralsund. Kurz vor dem Abrücken wollten sie noch die jungen Männer aus dem Dorfe mitnehmen. Diese hatten schon Lunte gerochen und waren im Wald verschwunden. Meinen Großvater und noch einen jungen Mann haben sie geschnappt und mitgenommen. Bei Stralsund hat mein Großvater das Glück gehabt, zu fliehen, und ist zu Hause angelangt. Der andere junge Mann ist verschollen. wie die Franzosen fort waren, mußte Rövershagen noch Nachschub leisten an Lebensmitteln und so weiter. Das Dorf war ausgesogen und nichts mehr zu haben. Mit Mühe und Not wurde etwas Geld gesammelt und in einer anderen Gegend aufgekauft und geliefert.
- Ein französischer Soldat der Einquartierung hat oftmals gesagt, wenn des Abends die Sonne unterging und am Himmel erschienen lange rote Striche: Diese Striche verfolgen uns stets und sind die Ruten, womit wir noch einmal geschlagen werden.
- Als die Franzosen nach Stralsund zogen, mußten sämtliche Fuhrwerksbesitzer Bagage fahren. Wenn die Pferde flau wurden und konnten nicht mehr, so bekamen die Fahrer Schläge, und es ging weiter. Auf einem großen Gute in der Nähe Stralsunds wurde Quartier bezogen. Die Pferde kamen in den großen Stall, wo ein großer Querbaum vorgelegt wurde. Die französischen Wachen sind übermüdet und liegen im festen Schlaf. Die Fahrer beratschlagen und werden sich einig: Es mag kommen wie es will, diese Nacht müssen wir entfliehen. Der Riegel ist ein gewaltiges Hindernis, aber die Tür ist hoch. Vor den Riegel wird soviel Dung gepackt, und mit Mühe, Angst und Not kriegen sie alle Pferde heraus und entladen die Wagen. Die Wachen werden nichts gewahr, sie sind zu müde. Nun ist alles so weit in Ordnung, aber den Weg, den sie gekommen sind, können sie der Sicherheit halber vorläufig nicht benutzen. Auch hierin finden sie Rat. einer der Fahrer hat früher auf diesem Gute gedient und weiß genau Bescheid. Ein großer langer Roggenschlag nimmt die Fuhrwerke auf, und vorsichtig geht die Fahrt vorwärts. Am Ende des Roggenschlags fließt ein Bach. Eine Furt ist vorhanden, alle kommen glücklich durch und gewinnen allmählich den richtigen Weg. Nun geht es im schnellen Trab, solange die Pferde es aushalten können, heimwärts. Alle sind glücklich zu Hause wieder angelangt.
- Diese Erzählungen stammen von meiner Großmutter und anderen alten Leuten aus Rövershagen. für deren Erzählungen hatte ich in meiner Jugend großes Interesse. :Inzwischen bin ich ein alter Mann, 1861 geboren.
- Heinrich Suhr, Bauer in Rövershagen (gestorben 25.November 1936, 75 Jahre alt)
- ( NHG )
Das Rövershäger Heiratsexamen
(KFC Röv. Nr. 80)
Von der „Rövershäger Schweineordnung“ 1819 zum Verbot der Waldweide
Die langjährigen Bemühungen des Forstinspektors Becker nach Abschaffung der Waldweide, die im Interesse einer ungehinderten Aufforstung unumgänglich wurde, trafen auf wenig Gegenliebe bei Pächtern, Einliegern der Heidedörfer und Teilen der Rostocker Bürgerschaft. Die Bewohner der Dörfer hatten stets den Standortvorteil des nahe gelegenen Waldes genutzt. Insbesondere die Schweine zur Eichelmast in die Waldungen zu treiben. Ein zusätzlicher Konflikt bahnte sich 1819 an, als auf Betreiben des Forstinspektors auf einer Sitzung des städtischen Heidedepartements am 10. April 1819 folgender Beschluß gefaßt wurde: „Da durch das freie Umherlaufen der Schweine in den Dörfern der Rostocker Heide manche Unordnung entstanden, auch Zäune und Gräben beschädigt worden, so wird zur Abstellung solchen Unfugs für die Zukunft hierdurch verordnet und festgesetzt:
- 1. Es darf kein Einwohner der Heideortschaften seine Schweine im Ort frei umherlaufen lassen.
- 2. Für ein jedes dennoch betroffene und eingefangene Schwein hat der Eigenthümer desselben neben dem Ersatz der Futterkosten und des etwa veranlaßten Schadens ein Pfandgeld von 4 Schillingen zu erlegen, dessen eine Hälfte an den zum Pfänder angenommenen Armenvoigt Peters, zur anderen Hälfte an die Rövershäger Armenkasse abgegeben werden soll.“
Dieser von den städtischen Behörden auch als „Schweineordnung“ bezeichnete Beschluß scheint aber zunächst kaum befolgt worden zu sein, denn nach zweieinhalb Jahren sah sich Becker am 15. November 1821 zu folgender erneuter Klage und Aufforderung zu verschärften Maßnahmen veranlaßt: „Da die hiesigen Hausleute ihre Schweine, die während der Herbst- und Winterzeit nicht mehr von der Hufe gehen, frei im Dorf herumlaufen lassen, und dadurch nicht nur die Gräben, welche die Stadt mit beträchtlichen Kosten hat aufziehen lassen, nachgewühlet, die angepflanzten Bäume, Zäune und Befriedungen niedergeworfen und Saaten und Weiden leiden,so kann ich nicht umhin , diesen Unfug anzuzeigen und darum zu bitten, dem Schulzen aufzugeben, diesem Unfug ein Ende zu bereiten und den Hausleuten bei namhafter Strafe anzudeuten, ihre Schweine ohne Hirten nicht von ihren Hofställen zu lassen.“ Die Behörden in Rostock reagierten relativ rasch und bestellten zum 27. November 1821 den Rövershäger Schulzen Hoff nach Rostock. Laut überliefertem Protokoll der vom Rostocker Senator Steinbeck geleiteten Unterredung glaubte Hoff, „Daß dem Übel abgeholfen werden könne, wenn jedem Hausmann soviel Material zu Pfählen und Buschwerk verabreicht werde, als zur Umzäunung eines Schweinehofes nötig sei.“ Dieser Vorschlag wurde jedoch strikt mit dem Hinweis abgelehnt, „daß wenigstens jetzt auf eine vermehrte Holzverabreichung nicht zu rechnen sei, und somit ein jeder schuldig sei, seine Schweine ohne dies in freier Hofwehr zu halten und es jedem selbst überlassen bleiben müsse, Mittel aufzufinden, wie dieses nach den Verhältnissen seines Hofes geschehen könne.“ Der Dorfschulze wurde in die Pflicht genommen, allen Einwohnern in Rövershagen bekannt zu machen , „daß der Besitzer eines jeden außerhalb der Hofwehr gefundenen Schweins eine Strafe von 16 Schillingen genommen werden sollte.“
Ne „wohrhaftige“ Späukgeschicht beläwt un vertellt von Richard Suhr
- Dor, wur sick in Rövershagen nu dei Graaler Schossee von dei Rostock-Stralsunder aftwält, liggt ein urolles Buernhus. Kein Wunner, wenn’t son’n bäten duknackt dorsteiht, denn dat dreggt jo ok all dei Last von vierhunnert Johr up siene Stänners. För mi ist’ aewer dat schönste in’n Dörp, denn hier bün ick buren un tagen, un aewer sienen Süll güngen mien Vörfohren Johrhunnerte lang in gauden un slichten Dagen. Hüt is dei Hauw in anner Hän’n, aewer ümmer, wenn ick up dei Dörchreis mienen Heimaturt krüzen dau, nähm ick noch fix ‘n Ogvull von mien Weigenstäd mit, wenn ick dor aewer tau Besäuk bünn, denn möt ick dor ümmer ‘n Tiedlang stillstahn, un väle bunte Biller ut mien Kinnertied trecken an mien Seel vöraewer. Dat duert aewer ümmer gor nich lang’, denn trädt ein Bild scharp in’n Vördergrund, un dat is dei verflixte Späukelabend, den’n ick dor as lütt Jung sülben mit biläwen müßt.
- Vadder harr ne frische Hauw in’n Dörp aewernahmen, un Großvadder bewirtschaftete noch einige Johren dei olle. Wiel ick nu so’n lütten Vertog von mien Grotöllern wier, blef ick up dei olle behacken. Wur wier dat aewer ok einmal schön, vörut in dei Schummerstun’n, wenn Grotmudder spünn un Grotvadder Geschichten vertellen ded. Wenn in’n Harwst dei Storm üm dei Uhlenfast hulte, wenn dei Rägen an dei Ruten kloetern ded, wenn in’n Winter Snei vör alle Dören leg, denn stünn ick in Grotvadder sienen Pannerstall un läste em jedes Wurt von’n Mun’n af. Dei Waur treckte denn in’n Sneidräwel vorbi, Jäger Hinz, dei sick in dei Heier (Heide) dotschaten harr, kem up sienen Schimmel ut dei Dannenschonung tau rieden un verfierte dei Holtarbeiters, Jäger Brandt, den’n vör Johrhunnerte dei will Bier terräten harr, steg ut sien einsam Graw weder rut, dei Klatthamel, dei up dei Buerwischen ümgüng, würd dörch dei Heierjungs erlöst, un wat süß noch alls „as nix Gaudes“ ümgüng, stellte mi Grotvadder wohrhaftig un läwig in dei Dönz rin. Ick wüßt tauletzt all ümmer wat kem, wenn Grotvadder sienen Mund upmaken ded, aewer dat wier doch ümmer wedder nie un schön.
- So seten wi einmal wedder in’n späten Harwst in dei lütt niedrig Dönz. Grotmudder spünn so flietig as ümmer, un Grotvadder vertellte. Dat wier dissen Abend all lat worden, Grotvadder, dei all lang’ giern unner dei gries Gaus krapen wier, luerte noch up den’n Snieder Chrischan Stier, dei em tau einen niegen Antog Maat nähmen wull. Up Chrischan wier aewer nich recht Verlaat. Hei sükte „an’n drögen Swamm in dei Bost“ un müßte den’n von Tied tau Tied eins düchtig anfuchten. Säker harr hei sick diersen Abend wedder eins in’n Kraug, dei ‘n bäten utbugt leg, vör Anker smäten. Eigentlich harr sick Großvadder aewerhaupt mit em vertürnt. In dei schräben Dörpgesetzen stünn dat nich in, aewer dat wier so Aewerlieferung von öllings her, dat dei Snieder von jedes Tüg tau’n Antog soväl affsnieden künn, as tau ein West hüren ded, un dei Kun’n müßten sick bi den’n Inkop mit dat Maat dorup inrichten. Nu harr hei von den’n Antog, den’n hei Grotvadder verläden Johr makt harr, Tüg för twei Westen affsnäden, un Grotvadder sien Kittel un Büx wieren man bannig hündlich utfollen. Dei Arms un dei Beins wieren väl tau kort, un Großvadder wier mächtig in dei Braß geraden un schüll up den’n verdammten Snieder, dei em tau’n Spektakel un Peijatz för dat ganze Dörp mackt harr. Wiel hei von Natur ut aewer siehr gaudmäudig wier, let hei sick doch weder von den’n Snieder begäuschen, as dei en säd, hei wull em gegenaewer för alle Tieden up sien Extradeputat verzichten, un hei brukte nie nich wedder miehr Tüg köpen, as hei grad bruken ded. Grad, as hei sienen Arger aewer den’n Snieder siene Untauverlat Luft maken ded, swunkt dor buten wat vör dei Finstern aewer. Dat künn blot Chrischan sien, denn hei güng an Krücken un wier soans an sienen Gang gaud tau ken’n. Chrischan kem ok glieks in dei Dönz. As Grotvadder em dei Lex verhürt harr, nehm hei em Maat un wiel son’n bäten dick Luft wier, hüll hei sick gor nich wieder up. Grotvadder wull noch eins in’t Wäder kieken, un soans geben wi beiden em dat Leit bet vör dei Dör. Dat wier ein ganz schattig Wäder. Dagelang harr dat egal weg rägent, un in dei Dörpstraat, denn dunntaumalen wier dei Graaler Schossee noch nich, wier gor nich tau grün’n. Hart an dei Hoffstädt, up son’n lütten Anbarg, leg dei Kirchhoff, aewer den’n dei Lüd bi slicht Wäder ümmer raewergüngen. Dei Kirchstieg wier drög un gaud, un sei sneden somit dat madigst En’n von dei Straat af. Wi harrn den’n Snieder bet an dei Kirchspurt nahkäken un wull’n grad nah binnen gahn, as wi einen fürchterlichen Schrie von den’n Kirchhoff her hüren deden. In dennsülwigen Ogenblick segen wi ok, wur dei Snieder as son’n verfierten Zägenbuck ahn Krücken in groten Sprüngen ut dei Kirchspurt rutgehopst kem. Hei störmte an uns vörbi un stünn nich Räd’ noch Antwurt. Wi lepen em nah un segen em in fleigende Angst in Grotvadder sienen Lähnstaul sitten. Ut seg hei as Kalk an dei Wand, un dei dicken Sweitdruppens lepen em ümmer pieplings an dei Näs’ un Backen dal. Wi wiern all bannig verbast, un :Grotvadder frög, wat em denn eigentlich bemött wier. Den’n Snieder flögen vör Uprägung dei Kinnladen, man snacken künn hei kein Wurt. Großmudder lep in dei Koek un halt’ em ein Kumm vull Kaffee, üm em ‘n bäten tau vermünnern, man hei künn den’n Kumm gor nich hollen un schülwerte sick den’n Kaffee aewert Bostdauk. Grotmudder göt em den’n Kaffee in’n groten Pott, aewer den’n Scnieder sengelten so dei Arms, dat hei ok dorut nich drinken künn. Dat duerte rume Tied, ihrer hei sick sowiet verhalt harr, dat hei Bericht gäben künn. Endlich kem hei dormit vörtüg: „Up’n Kirchhoff späukt dat!“ Ut dat Liekenhus, wat an dei Kirch anbugt wier, un wur dei Stieg hart an vörbigüng, harr ein gräsig Beist ut’ Finster käken un em up dei Schuller kloppt. Mi lütt Butscher wier natürlich all lang’ dei Prük hochkamen, denn ick harr noch nie seihn, dat ein grot Minsch so ut dei Kunternanz kamen künn. Ick harr an Grotvadders sien Vertellers noch nie twiefelt, nu harr ick aewer doch den’n Bewies, dat in Rövershagen allerlei Unheimliches begängn wier.
- Grotvadder güng in deipe Gedanken dörch dei Dönz. Up einmal gef hei sick ‘n Ruck un säd tau Chrischan, hei künn sick dat gor nich denken, sei wull’n beid hengahn un sick dat aewertügt maken. Dei Snieder, dei noch ümmer as Waddick un Weihdag in sienen Stauhl set, verfierte sick ganz bannig aewer dit Ansin’n un säd, dat em dor kein vier Pierd hennkriegen deden. Grotvadder, dei woll gloeben ded, dat dei Snieder sick alls inbildt harr, wiel em von’n Kraug her son’n lütten unner dei Mütz set, wull sick dat aewer doch aewertügt maken un dei Sak up’n Grun’n gahn. Hei halte sick sienen Eiken achter dat Schapp rut un rep sick Peitern tau Hülp.
- Peiter wier sien Hoff- un Heierhund, ein ganz truge Seel, dei sick bether noch in alle Lebenslagen bewährt harr. Up em set’te Großvadder sienen ganzen Verlat. In dei Familie güng aewerhaupt dat Meinen, dat dat Geschlecht Peiter äbensolang’ up den’n Hoff begäng’ wier as dei eigen Vörfohren. Wenn ein Peiter abgängig wier, wier ein jung’ wedder ranwussen, un up dissen letzten harrn sick all dei Eigenschaften, dei einen echten Hund utteiken deden, ut dei lang’ Geschlechterreig aewerdragen. Peiter hörr dei Käuh allein. Grotvadder hülp em einmal rut un güng denn eins mit em üm den’n Block rümm, den’ hei aewerhäuden süll. Wenn dei Käuh middags uns abends rinn sülln, würd blot up’n Finger fläut’t, Peiter bellte eis un bröchte sien Haud tau Hus. Süll ein frisch Kawel aewerhött warden, denn würd em dei wedder anwiest. So verwachte Peiter trug sienen Posten un harr sien tweibeinten Kollegen gegenaewer dat vorut, dat hei nie nich slep. - Nachts wier hei Wachhund. Uenner den’n Schutz von dat breide Walmdack nah dei Schossee henn stünn ne Bänk. In dunnmalige Tieden kem dor väl fröm’m Volk dörch, Zigeuners, lütt Hannelslüd un Reisners, dei in warme Sommernachten dei Bänk giern as Slappstäd benutzten. Peiter leg up dei Binnensiet von dei Wand un künn dei Bänk von dor dörch dat Finster in Ogenschien nähmen. Hei wier ok hier bannig up’n Posten. Bleben dei Slapgäst up dei Bäkn, denn let hei sei in Raug, güngen sei aewer up den’n Hoff, denn lep hei in’n Alkum, wur Grotvadder slep, störr em mit dei Pot an dei Schuller un wohrschugte em. Grotvadder brukte sick nu blot dei denkbor wenigsten Uemstän’n tau maken. Hei dreihte sick in’n Beer, hakte dat Finster up, Peiter sprüng rut, bröchte dei ungebäden Gäst up dei Söcken, hüppte wedder rinn, dat Finster würd slaten un dei Saak wier vörwäst.
- Up Peitern verlet Grotvadder sick hüt. Dei harr ok all lang’ markt, dat wat Besonners los wier un wiekte nich von sien Sied. Chrischanen kemen dei kollen Gräsen an, as Grotvadder em noch eis wedder inladen ded. As ick nu seg, dat ut dei Geschicht Iernst warden ded, stünn för mi fast, dat ick den’n ollen Mann taum letzten Mal läwig seihn ded. Ick höll em an dei Kittelslipp wiß, denn ick höll doch tau väl von em, aewer hei let sick nich bedüden, dat Schicksal müßt sienen Gang gahn.
- Grotvadder güng forsch up den’n Kirchhoff tau. Hei kem aewer blot äben bet an dei grot Lin’n. Dor stünn hei, as wenn hei anwöttelt wier. Ut dei Dör von dat Liekenhus kem ein grugelig Wäsen rut, von aewer Mannsgröt, piel up em tau. Sülwst Peiter harr sien Bedenken, ok hei verstutzte sick un stünn bohmstill. Ick will Grotvadder, dei bether doch väl Kraasch un Maut opbröcht harr, nich minn maken, aewer ick mücht doch annähmen, dat hei sick mit den’n Späuk nich wieder bemegeliert harr, wenn Peiter nich glieks sien Besinnen wedderkrägen harr. In Nullkommanix wier hei achter den’n Späuk un grep em in dei Fessel. Dei Späuk krönnigte hell in dei Nacht rin un preschte up dei Purt tau, dat wier — Grotvadder sien Schimmel! Dei Oll stünn all prat, denn dei Stimm harr hei kennt, un hei, dei sien Pierd leiwer nix dahn harr, hei gew em nu doch mit den’n Eiken von achtern einen mit up dei Reis’ un rep: „Un du Delf, du wist hier Lüd grugen maken?!“ Dei Schimmel, den’n dat Späukspälen nu so verleden müßt, nehm sien Tauflucht weder tau sienen Stall. Sien Herr lep em nah, un hier klorte sick denn jo alls up. Dei Schimmel wier wählig wordn in’n Stall, harr sick den’n Halfter afströpt un denn dat Dwaßholt, wat in dei Dör leg, mit’t Mul rutstött. So harr hei frie Bahn krägen un wier up sienen Spaziergang int Liekenhus geraden. Dör un Finster harrn taufälligerwies’ apenstahn, dormit dei Fautborrn, den’n sei bi den’n letzten Kirchgang so vullperrt harrn, wedder updrögen süll. As nu dei Snieder antauwuppen kem, hett dei Schimmel säker ‘n bäten ut dat Finster käken un mag em jo ok woll mal mit dat Mul up dei Schuller stött hem’m. Doraewer hett dei Snieder sick jo nu ok mit Recht so dägern verfieren künnt, dat hei afsacken ded un denn heisterkopp von’n Kirchhoff jumpte, so fix, as sien lahmen Bein dat jichtens tauleten. Grotvadder sammelte dei beiden Krücken vör dat Finster up un kem as so’n Matador dormit nah dei Dönzendör rinn. Ick freute mi, dat ick den’n ollen Mann wedderharr, Chrischan aewer kek em an, as müßt nu ne schreckliche Apenborung kamen: „So, Chrischan“, säd Grotvadder, „nu ingst di nich mihr, ick heff den’n Späuk anbun’n, denk di mal, uns’ Schimmel hett di grugen makt!“ un dormit vertellte hei den’n ganzen Hergang. Un dunn gef hei em sien Krücken wedder: „Hier hest din Gangwark, nu kannst du beruhigt nah Hus gahn.“
- Chrischan güng aewer nich, künn hei ok gor nich, denn hei wier nix as ‘ne lädweik Plün’n. Grotmudder harr denn ok glieks Erbarm mit em un makt em ein Nachtlager in’n Alkum trecht. Mirrnacht wier all lang’ vöraewer, as wi endlich tau Rauh kemen. Up einmal würd dat ein fürchterliches Toben, Stähnen un Schrieden in den’n Alkum. As ick mi vermünnert har, lep mi ümmer ein Schudder naht anner aewer den’n Puckel. Ick schriete aewer Grotvadder, Grotvadder rep Peitern, Peiter stünn all bi uns un günste, hei künn dor in’n Düstern ok woll nich klauk ut warrn, wat los wier. Grotmuder wier all in dei Wahndönz, wur sei sick inquartiert harr, ut ehr Lager sprung’ un söchte Rietsticken un Licht. As sei endlich mit Licht kem, dor leg Chrischan up’e Knei in’n Beer, harr sick mit dei Hand upstüt’t un schüerte sick mit dei anner den’n Kopp. Sien Aewerbett leg an dei Ierd, un hei jammerte tau’n Erbarm. Hei sackte ganz in sick tausamen un seg ut, as wenn alle Späuken ut Rövershagen up einmal üm em rümstün’n un dat up em afseihn harrn. As Grotmudder em gaud tauräden ded, vertellte hei, dat hei äben as ganz wiß un wohrhaftig up Läben un Dod mit den’n verdammten Späukschimmel üm dei Wett lopen wier. Dei Reis’ harr üm dei Kirch rümgahn. Na, dat künn denn nu ok gor nich anners sien, as dat dei Schimmel em in sienen kroepeligen Beinverfat inhalen ded. In sien Hartensangst wier hei in dat Liekenhus rinnjumpt un harr dwaß dörch dei Kirch lopen wullt. Dei Kirchendör wier aewer tauwäst, un dun’n wier hei mit alle Wucht mit den’n Kopp gegen dei Dör butzt un ... upwakt. Dat letzte harr ok sien Richtigkeit, man dat hei nich gegen dei Kirchendör, woll aewer mit den’n Kopp gegen dat Tennstbrett an dat Koppenn’ von dei Beerstell fohrt wier. Ein dägt Brusch hett dat noch lang’ ogenschienlich utwiest.
- Wenn dei Snieder an diers Späukerie ok noch lang’ tau süken harr, so hett sei doch ein Gaudes för em hatt, hei is nie wedder tau Kraug gahn, denn dei Weg wier em doch tau dull verled’t. Wi all aewer koenen dei Liehr ut trecken, dat dei düllste Späukerie sick letzten Enns doch ganz natürlich tau Wäg leggt.
- ( NHG )
"Werner Kröplins Trauma von´n Wulf in de Rostocker Heid" (nahvertellt von Kurt Kaiser)
- 1944 wier min ierst Wihnachten, dat ick nich tohus fieern künn.
- Ick wier 18 un as Kriegsfriewilliger mit 17 tau´n Frontinsatz intreckt un poor Maand later in Kriegsgefangenschaft geraden.
- Nu beläwte ick twei Johr in de USA un noch mal twei Johr in Englande.
- Alle Wihnachten wier´n dor vuller Heimweh, man gaud, dat ick dunn Werner Kröplin ut Rövershagen drapen heff.
- Hei künn so wunnerbore Geschichten von tohus, in´ne Rostocker Heid vertellen.
- Ein dorvon, Wihnachten ´44 in Virginia, is mi unvergätlich.
- Ick rekonstruier se nu mal, as se mien Gedächtnis mi bewohrt hett:
- "Wenn an´n Harwst un Winterdach de Storm üm uns Hus üm den Rövershäger Forsthoff hulte, knarrten un klagten de Böm un Strüker.
- In´n Aben knackte dat Füerholt, ein Petroliumfunzel blökerte. Dat rök na Bratappel un frischbacken Brot.
- Uns Ollen vertellten sick wat gruglichet oewer Blitz un Dunner, Dod un Düwel, oft ok von´n König un Krieg.
- Wie Kinner luschten.
- Dor hett dat ok mal heiten, dat in den strengen Winter ´28, as de Ostsee taufroren wier, von Finnland her, ein Wulf oewwer dat Ies kamen un in uns Holt afdückert wier.
- Dat süll ´n mächtig Diert sien un nu dor rumströpern.
- Manke Lüd wull´n em all seihn hemm., keiner künn´t bewiesen.
- Sei vertellten grugelichtet oewer den "Finnenwulf", as se em nennten.
- Oewwer denn wür einet Dachs de Köhler näben sien Kohlenmieler dot upfunn´.
- De Förster künn nich faststell´n ob de all stark verfuulte un anfrätene Köhler von´n Wulf orrer von ne Rott Swien so tauricht worden wier,
- Un einet Dachs bröchte dat Schicksal mi in´t Spill.
- Mien Vadde har acht Pierd mit de ick all mien Schaultied Holtslöpen lierte.
- Wiel dat ick em den Knecht ersetten künn, dörfte ick mit Vadders Rietpierd af un an mal utrieden.
- Mit den jungen Hingst galoppierte ick giern mal dörch de Heid.
- An einen Nahmiddach in´n Harwst, de Sünn stünn all tämlich deip un blend´te, as ick mit Vadders "Swatten" oewer den Holtslöp-Damm dörch dat "Naturschutzgebiet Hütelmoor" galoppierte.
- Dor stünn mit´n mal de Finn vör uns.
- Dor liggen woll blots twindig bet dörtig Meter twischen uns.
- As ick all säd: de Sünn stünn deip un mi keem dat Diert sihr grot vör.
- Min Vadder sien Pierd woll ok, denn dat schuchte un bremste, dat ick in´n Boen vörnoewer runnerföll un ahnmächtig liggen bleef. De Hingst brök in´n hogen Bagen vörnoewer runnerföhl un ahnmächtig liggen bleef.
- De Hingst brök siedwarts ut dörch dat Unnerholt un stör´te int Muur, wo he nich wedder rut keem.
- As ick denn ut mien Koma upwakte wier dat dodenstill: Kein Wulf un ok kein Pierd!
- Ick dacht, dat et allein in Panik nahus lopen wier.
- Ick slöpte mi denn de Kilometers nah Hus.
- Intwischen wier´t düster wor´n, so dat ierst an´n näksten Morgen de Säukerie na Vadders Rietperd los gahn künn.
- Oewer ick leeg mit Brägenerschütterung all up de Krankenstation.
- Dit wier ein grot Katastroph in mie´n Läben.
- Ein Droma makte mi depressiv un ok aggressiv. Ic künn unsen Schäperhund nich mier lieden, de einen Wulf so ähnlich seech.
- Ick wier froh dat ick twei Maand dorna Soldat wür.
- Mit rieden har ick nix mihr an´n Haut un wull dat Heidbeläwnis mit den´n Finnwulf vergäten.
- Oewer dat mien dat mien Vadder mi de Schuld an´n Dod von sien Pierd geef un nich verteien künn, un mien Beläwnis mit den´n Finnwulf nich gloewen wull, quälte mi sihr.
- Wi künn´n uns nich wedder verdrägen, denn as ick up Fronturlaub keem, wier hei all storben.
- Sonne posttraumatischen Qualen ward man woll nie mihr los un man möt lier´n, dormit ümtaugahn.
- Mank ein hier in´n Lager leed dorünner, dat de Krieg verlur´n güng.
- Wi har´n em nich von´n Tun bräken süllt!
- Ick leed, dat mien Vadder mi nich mihr verteihn künn und du Kurt, littst dat du nich Wihnachten tohus fieer´n kannst.
- Oewer dat vergeiht:
- Wenn du näkst Johr werrer tohus büst, is dit Leed vergäten!"
- Dat säd to mi 1944 Werner Kröpelin ut Rövershagen.
- Gans hett he nich recht behollen, denn noch drei Wihnachten möst ick in´ne Fröm´fier´n, oewer nu beläw ick all 67 Johr dat Fest mit mien Familie in Fräden.
- So ein Glück wünsch ick alle Minschen up uns Ierd.
- Juch all, leiw´Frünn´:
- Frohe Wihnachten un´n gauden Rutsch in´t niege Johr.
- Kurt Kaiser
- ( NHG )
Die Rövershäger Mühle
in Vorbereitung
Aus dem und über das älteste Kirchenbuch Mecklenburgs
(NHG)
- Das älteste erhaltene Kirchenbuch Mecklenburgs stammt aus Rövershagen.
- Es befindet sich im Rostocker Ratsarchiv.
- Pastor Johann Gryse zeichnet darin kirchliche Ereignisse in der Zeit von 1580 bis 1605 auf.
älteste Dorfansicht von Rövershagen auf der Lust´schen Reiterkarte von 1696 (Quelle: Archiv der Hansestadt Rostock)
- Das Kirchdorf Rövershagen, 12 Kilometer östlich von Rostock am Eingang zur Heide gelegen, wird 1305 zuerst in den Urkunden erwähnt.
- Ehemals aus Ober-, Mittel- und Niederhagen bestehend, bildete es mit den zugehörigen Heideortschaften und Wohnstätten die einzige Landgemeinde unter der Schutzherrschaft der Stadt Rostock und soll ursprünglich eine Filiale von St. Marien gewesen sein.
- Seine Kirche, die vielfach baulich verändert worden, entstammt dem Anfang des 14. Jahrhunderts. die Tafel mit dem Pastorenverzeichnis hinter dem Altar nennt als zweiten Pfarrherrn M. Johann Griese (Gryse), und ihm verdanken wir ein altes Kirchenbuch, das er während seiner Amtszeit, 1580-1605, mit großer Sorgfalt geführt hat.
- Griese war Rostocker und kam vermutlich 1579 nach Rövershagen, nachdem er in Sanskow in Pommern verschiedener, nicht bekannter Ursachen wegen seines Amtes entsetzt war.
- Er war mehrmals verheiratet und wir wissen von sieben Kindern, drei Söhnen und vier Töchtern. von den am ersten Advent 1580 geborenen Sohn Adam, dessen Mutter die Rostockerin Anna Bonsack war, erzählt der Vater 1596 voll Stolz: "Mynn Szöene Adam hefft ihnn III Jahren dhe Bibell 6 mael dorch gelesen, III maell de Latinsche unde III maell dhe Dudesche, alle dage ihnn eyner ideen 8 Capitell. Geendeth ihm havengeschrevenn Jahr, dhen 18. Septembris, Szonnavendes vhor dhem 15. Szondage post Trinitatis."
- Rövershäger Leben als lebendiges Kulturbild
- Er entwirft in seinem Kirchenbuch ein überaus anschauliches Kulturbild seiner Zeit, denn er beschränkt sich nicht auf Eintragung seiner Amtshandlungen, sondern alles, was ihn und seine Gemeinde bewegt, findet Beachtung.
- Er hat im ganzen 329 Taufen, 281 Beerdigungen und 87 Trauungen vollzogen.
- Von den alten Familien leben die Suhr, Hoff und Peters heute noch im Dorf, auch Nachkommen und Verwandte der Keding und Borgwardt.
- Von der Taufe
- Die Kinder pflegen noch nicht, wie die Kirchenordnung von 1602 vorschreibt, bis zum dritten Tag nach der Geburt getauft zu werden, sondern nach acht oder auch zehn Tagen.
- Sie haben meist fünf Gevattern und erhalten nur einen Namen.
- Besondere Beachtung schenkt der Pastor den 1601 geborenen Drillingen eines Gräbers im Moor, aber leider bleibt keins von den Kindern am Leben.
- Von der Bestattung
- Die Beerdigungen finden gewöhnlich schon am Tage nach dem Tode statt.
- Wir hören von plötzlichem Sterben durch Seuchen und Unfälle.
- Ergreifend ist das Schicksal des Harmen Burmeister, Schafhirt zu Oberhagen, der 1597 Frau und 7 Kinder an der Pest verliert.
- In den drei Krügen des Dorfes, von denen die beiden "bhi dher Kercken" und "bhi dhem Landwege" schon 1305 errichtet werden, kosten Unbeherrschtheit in Trunk und Spiel manches Opfer.
- Die uralte Sitte, den Getöteten als den Hauptkläger selbst vor Gericht zu bringen, herrscht noch, denn "dhe levendige" wird "bhi dhem dhodenn vhor dath Recht gebracht".
- Landsknechte überfallen das Dorf
- Am 6. November 1601, kurz vor Abend, zieht ein Trupp Landsknechte raubend und plündernd durch Volkenshagen.
- Hans Schade meldet es in Rövershagen, die Sturmglocke wird geläutet, und etliche Einwohner eilen den Nachbarn zu Hilfe. Mehrere Landsknechte werden verwundet und drei Leute getötet:
- Ein Landsknecht, ein Volkenshäger und Chim Westvall (Chim = Joachim) aus Rövershagen, der nach dem geltenden Recht mit den andern in Volkenshagen beerdigt wird.
- Griese setzt hinzu:
- "Dhen alße eyner gelevet hefft, sho ihs ock gemeinlich sinn Ende."
- Trabant des Dänenkönigs beigesetzt
- Fast zwei Monate vorher muß er einen Trabanten des jungen Königs von Dänemark zu Grabe bringen, der verunglückt als das Königspaar mit drei Schiffen, angeblich um der Pest zu entfliehen am Moore vor Anker liegt.
- Er schreibt: "Ihs desße Dode ihnn eynem finen nienn Szarcke ahngeschlagenn to wather bhi dem Moere, Bavenn dath Szarck ihs eyne leddige tunne gebundenn, welcker dath szarck ihm water havenn geholden.
- Up dhem Szarcke ihs mith Rotstene ein Crutze gemaketh, mith volgender schrifft:
- Königlicher Maiesteth Dravante Hinrich vhann Hildenßen, up dhem Schepe vhann dher Spelle dodt geschlagenn.
- Up dath Szarck sßind ok II Daler ihnn eynem plunde vasth genegelt gewest.
- Dhenn eynenn daler hefft dhe paster, kosther unde vorstender uhnn alles vhor dhe beerdige und Klocken bekamenn, dhenn andern daler hefft dath volck vordrunckenn, dath eynn tho grave gebracht, ihs ok Christlich beerdigeth wordenn,"
- Kirchenzucht
- Kirchenzucht wird geübt.
- Claus Wullenböeker, der "godt loße Gadesvorgeter" wird 1593 "ahne ßinenth unde klingenth" begraben, aber auf Fürsprache erhält er doch einen Platz auf dem Kirchhof und nicht an der Mauer.
- Jagd für die Hochzeit des Bürgermeistersohns
- Der Tod vieler namhafter Rostocker wird berichtet, aber auch frohe Ereignisse aus der Stadt, z.B. die "reiche koste" bei der Vermählung des Bürgermeistersohns Hermann Lemke mit Dr. Markus Luschows Tochter, für die zwei Wochen lang in der Heide gejagt und außer Hasen und Rehen vier stattliche Hirsche erlegt worden sind.
- Entwicklung des Kirchspiels
- Häufig enthält das Kirchenbuch Eintragungen über bauliche Veränderungen.
- 1593 wird der "Predigstuell" von Meister Blasius Auer aus Rostock hergestellt.
- Die Gesamtkosten belaufen sich auf fast 30 fl. (Gulden), die etwa zur Hälfte aus den Beiträgen aller Berteiligten, im übrigen aus dem Kirchenvermögen bestritten werden.
- Bei dieser Gelegenheit kann der Pastor es sich nicht versagen mitzuteilen, wie tatkräftig er im Kirchspiel gewirkt hat "ihn erbuwing der wedem (Pfarrhaus), Schune, Backhus, Szod und Hackelwerk (Umzäunung), Item ihn dher Kercken, dhen Predigstuell unde dhe andernn stöele, item beide Dörer vhor denn Kerckhoff" und schließt daran den Wunsch:
- "Myne Nakömlinge mögenn my iho (stets)thor Danckbarheid gnade davor wunschenn unde biddn van Gnade unde myner ock sunsth vor dhenn Mynschenn ihn allem besthen gedencken." -
- Der Bau des Pfarrhauses, das in seinen ältesten Teilen bis 1870 bestanden hat, beginnt schon 1580. zur Scheune steuert Griese 1589 selbst bei durch Lieferung einer Tonne Bier zum Richtfest und einer Vimme (Ladung) Stroh zum Dach.
- Fast 40 Jahre später wird sein Sohn und Nachfolger im Dreißigjährigen Krieg von Haus und Hof vertrieben.
- Von Interesse ist die Bemerkung aus dem Jahre 1589:
- "Ihnn desßen kamer ihs ok tho Rostock dhe stuve thorm tho S. Jacop affgenamen unnd dath Spitzkenn ßamt eyner nienn stundekloken wedder upgeßetteth."
- Allerlei Anschaffungen werden gemacht.
- 1586 erwirbt man in Rövershagen wie in den umliegenden Gemeinden auf Befehl des Herzogs Ulrich vier Bücher für zusammen 8 fl. (Gulden), 4 ß (Schilling) lübsch, nämlich die Bibel und Luthers Hauspostille in deutscher Sprache, die Konkordienformel und ein Buch von den Sakramenten.
- Grieses persönliche Verhältnisse
- In demselben Jahr bereitet Griese seinere Frau zu Weihnachten eine Freude mit einem neuen Pelz und sich selbst mit einem langen Studierrock.
- Sehr vertraut ist er mit den wirthschaftlichen Verhältnissen. Auf Pferdezucht wird viel Wert gelegt.
- Ausführlich berichtet er von den Fällen, die seine Möder (Stuten) "Sterneke" und "Bruneke" zur Welt bringen.
- Seinem Schwiegersohn Peter Kock überläßt er im ersten Jahr der Ehe mit dem Brautschatz einen jungen Hengst "Sterneberch".
- Hart trifft es ihn, als 1592 seine größte und beste Stute "Plummeke", die ihm "vhor XX daler nicht veill whaas", und die alle Pferde in Rövershagen übertrifft, erkrankt und stirbt.
- Als Kind seiner Zeit gibt er dem Gerücht Raum, sie können ihm "uth affgunsth affgetovert (abgezaubert)" sein.
- Bösewichte im Dorf
- Bösewichte gibt es freilich im Dorf.
- Mit Genugtuung stellt Griese 1589 fest, das "Hans Plathe, de grothe vorwegenn Schalck tho Rostock ihnn dhenn Thorm geßettet", weil er nach vielen andern Uebeltaten am Osterdienstag während des Gottesdienstes Chim Westvall auf dem Wedenhofe ein Huhn totgeschossen und unter Beistand seines Bruders Benedikt eine Schlägerei begonnen.
- Sollte die Strafe Erfolg gehabt haben, oder ist der spätere Küster, den des Pastors Tochter Regina im nächsten Jahr ehelicht, ein Namensbruder jenes Benedikt Plate?
- Wiederholt werden Schädigungen durch Naturgewalten vermerkt, durch Stürme und Ueberschwemmungen, starken Frost, heftiges Gewitter und Feuersbrünste.
- Amtsübergabe
- Im Frühjahr 1605 entschließt sich der wohl mehr als 70jährige auf mehrfaches Bitten seines Sohnes Daniel, der schon einige Jahre mit seiner Familie auf der Pfarre gelebt hat, diesem sein Amt abzutreten.
- Von väterlicher Liebe zeugen die letzten Worte des Buches:
- "Geve ehm untze Godt gelucke altze He idt ahn my ßer woll vorschuldeth unde vordenth hefft, ßampt etlichemandern ßinenn Confortenn, Amenn."
* Kirchspielchronik Rövershagen von Hermann Friedrich Becker; 1839
To de Rövershäger Geschicht up platt (Läuschen un Rimels in uns tweit Amtssprak)
As Rövershagen to sienen Namen käm
Karl Suhr, ein Bauer aus Willershagen , wollte eines Tages nach Rostock gehen. Doch trieb sich allerlei Raubgesindel in der Gegend herum. Im Wald hält ihm denn auch ein Räuber die Pistole vor die Brust und verlangt: „Geld oder Leben! - Wat wist du? Dat Läwen?“ fragt Karl Suhr. „Wat wist du mit min bäten Läwen, dat sall doch wohl dat Geld sein, un dat will ik di ok giern gewen. Doch föllt mi ein Bedingung in. Min Frau, die glöwt mi dat nich, wenn ik ehr dat vertellen dauh. Sei ward mi nich glöwen , dat ik di dat Geld gewen heff, ahn mi tau wehren. Dorum wull ik blot dit ein: Scheit mi ierst ´n Lock dörch den Haut un denn noch ´n tweit dörch den Rock.“ Der Räuber tut ihm den Gefallen. Darauf Suhr: „Nuok noch ´n Lock in de anner Siet von´n Rock, süs glöwt min Frau dat nich, un ik möt mi vör min Kind schämen.“ - „Nee“, sagt der Kerl, „´n annermal, denn grad sünd all min Kugeln all.“ - „Wat?“ fragt Karl Suhr, „du hest för mi kein Kugeln mihr? Denn rad ik di, holl di nich mir up!“ und schwenkt seinen Eichenstock. „Süs schlag ik di eins up des Schnut!“ Der Räuber – plattdeutsch „Röver“ - nahm Reißaus. Seitdem heißt das hier gelegene Dörf Rövershagen. (HG33)
Woans de Rövershäger Holtvagt eins de Hasen un de Fasanen gripen deit
De Rövershäger Holtvagt süll Hasen för den Großherzog scheeten. He verstünn sick oewer nich richtig up de Büß. Dorum güng he nah den Scheper un frög, wat he woll daun müßt. De Scheper wier enen ganzen Swinplitschen un seggt em, he süll sick man en bäten Snuwtabak halen un up jeden Chausseesteen wat upstreuden, denn dor löpen de Hasen dull nah. He makt dat nu ok, un an´n annern Morgen legen bi de Steen de Hasen. De hadden von den Snuwtabak wat nahmen, un denn bi dat Pruschen hadden se mit den´n Kopp up de Steen slagen un bleeben dot liggen. De Holtvagt wier nu ut alle Not un bröcht de Hasen to den´n Großherzog hen. As de nu to weeten kreeg, woans he to de Hasen kamen wier, un weggen dat utheckt har, let he sick den´n Scheper kamen un frög em, ob he ok Fasanen fangen künn. „Jawoll“, seggt he un löt sick dat Holt wiesen, wo de Fasanen sitten daun. De ollen Voegel sün je wat nieglich, dorüm lööp he ümmer rund um de Bööm rüm. Dorbo keken em de Fasanen ümmer nah un dreihte sick de Häls af un föllen so von de Bööm dal. He sammelt se up un bröcht se nah den´n Schweriner Hof hen. De Fürst hett em nu nich wedder ut de Finger laten un hett em sin Läw lang up´n Hof behollen. (HG75)
Wenn he nu französsch schnackt?
1807 kemen Franzosen ok in de Dörper, wecke an´n Rand von de Rostocker Heid´liggen doon. Se wiren gor nich so lang dor, oewer ümmer all lang noog, dat sick weck Dierns in de frömden Soldaten verkiken deden, un nah´n Dreivierteljohr keem denn ok richtig ein mit´n lütt Andenken to sitten. "Dat wier jo all noch gor nich so slimm", säd´de Grotmudder, "oewer wosall´t warden, wenn he nu ihrst an to snacken fangt un nümskann em verstahn."
Sagen, Geschichten und Legenden aus Rövershagen (hochdeutsch übertragen)
Wie Rövershagen zu seinem Namen kam
Karl Suhr, ein Bauer aus Willershagen , wollte eines Tages nach Rostock gehen. Doch trieb sich allerlei Raubgesindel in der Gegend herum. Im Wald hält ihm denn auch ein Räuber die Pistole vor die Brust und verlangt: „Geld oder Leben! - Wat wist du? Dat Läwen?“ fragt Karl Suhr. „Wat wist du mit min bäten Läwen, dat sall doch wohl dat Geld sein, un dat will ik di ok giern gewen. Doch föllt mi ein Bedingung in. Min Frau, die glöwt mi dat nich, wenn ik ehr dat vertellen dauh. Sei ward mi nich glöwen , dat ik di dat Geld gewen heff, ahn mi tau wehren. Dorum wull ik blot dit ein: Scheit mi ierst ´n Lock dörch den Haut un denn noch ´n tweit dörch den Rock.“ Der Räuber tut ihm den Gefallen. Darauf Suhr: „Nuok noch ´n Lock in de anner Siet von´n Rock, süs glöwt min Frau dat nich, un ik möt mi vör min Kind schämen.“ - „Nee“, sagt der Kerl, „´n annermal, denn grad sünd all min Kugeln all.“ - „Wat?“ fragt Karl Suhr, „du hest för mi kein Kugeln mihr? Denn rad ik di, holl di nich mir up!“ und schwenkt seinen Eichenstock. „Süs schlag ik di eins up des Schnut!“ Der Räuber – plattdeutsch „Röver“ - nahm Reißaus. Seitdem heißt das hier gelegene Dörf Rövershagen. (HG33)
Unterirdische in Rövershagen.
In Rövershagen vertauschten mal die Unterirdischen einer Frau ihr ungetauftes Kind gegen eines der ihrigen. Auf Rath eines klugen Mannes legte sie das Kind von den Unterirdischen auf den Haublock, als wenn sie es mit der Axt todtschlagen wolle. Alsbald war das Zwergenkind verschwunden und ihr eigenes wieder da.
- Pastor Dolberg aus Hinrichshagen, mündlich.
Man darf nicht erzählen, was einem begegnet ist.
(NHG) ? Um die Kosten des Ausrodens zu sparen, hat die Obrigkeit früher jedem Tagelöhner in den bei der Rostocker Heide gelegenen Dörfern erlaubt, die Baumstämme auszuroden. Der Tagelöhner M. aus Rövershagen geht zu diesem Zwecke einmal in den genannten Wald zu einem Ort, der die Feuerbachstelle heißt. Es ist gerade ein sehr warmer Tag. M. denkt, er will des Abends lieber etwas länger arbeiten und dagegen des Mittags sich eine Zeit lang ausruhen. Er legt sich deshalb nieder. Als er einige Zeit gelegen hat, hört er ein Geräusch, als wenn Menschen sich schelten. Er glaubt, es komme ein Wagen, um seine Stämme zu holen. Er will ihm deshalb entgegengehen. Je weiter der Tagelöhner aber geht, desto weiter entfernt sich das Geräusch. Es scheint immer in seiner Nähe zu sein, aber er kann es doch nicht erreichen. M. Geht somit wieder zu seiner Ruhestätte zurück. Da stößt die Betglocke und auf einmal hört das Geräusch auf. M. erzählt dies am Abend, als er nach Hause zurückgekehrt ist, seinem Vater. Dieser sagt, es sei nicht gut, daß er es erzählt habe, das werde ihm irgend ein Unglück bringen. Nach einiger Zeit geht unser Tagelöhner nach der Wiese, um sie zu mähen. Auf der Wiese überfällt ihn plötzlich ein Jucken und große Beulen zeigen sich auf seinem Körper. M. gebraucht Mancherlei, aber es hilft ihm nicht. Da sagt ihm Jemand, er müsse sich von drei verschiedenen Feldscheiden Steine holen lassen, sie glühend machen und nachher benässen. Nachdem die Steine herbeigeholt und von ihm naß gemacht worden sind, fängt seine Krankheit an abzunehmen und hört am Ende ganz auf. Pastor E. Wolff zu Rövershagen bei Niederh. 2, 84f.
Gespenstische Thiere
Auf dem Wege zwischen Niederhagen und Mittelhagen, behaupten Manche, laufe des Abends ein grauer Hund, der Denjenigen, der dort geht, begleitet. Einer hat sich sogar durch das Gesehene so vom Wege abdrängen lassen, daß er mitten auf das Feld gerathen und in einen ganz andern Weg hineingekommen ist. Als es hat nicht weichen wollen, hat er endlich ausgerufen ›Wo willst du Teufel hin!‹ Da ists verschwunden. In Hinrichshagen, sagte man vor einigen Jahren, erscheine öfters ein Fuchs, schaue bald ins Fenster, bald liege er vor der Thür, so daß man nicht aus und ein gehen könne. Wenn der Jäger darnach schieße, so falle er zwar und immer mit der Schnauze in den Sand. Wenn man ihn aber nachher aufnehmen wolle, so sei er verschwunden. Pastor E. Wolff zu Rövershagen bei Niederh. 2, 113 f
Herr von Hagemeister
(NHG) ? Zwischen Rostock und Ribnitz, ungefähr eine Viertelstunde von der Chaussée entfernt, liegt das Kämmerei- Gut Niederhagen. Vor vielen Jahren, so geht die Sage, wurde dies Gut von einem Herrn von Hagemeister bewohnt, der ein gar wildes wüstes Leben führte, seine Leute schlecht behandelte, und von dem man allgemein sagte, er und seine Frau hätten einen Pact mit dem Teufel geschlossen. An einem stürmischen, regnerischen Tage hat denn der Teufel sich auch des Herrn von Hagemeister bemächtigt, und ist mit ihm durch die Decke des Wohnzimmers gefahren. Der Frau von Hagemeister, die eben in den Keller hinabgestiegen, hat er das Genick umgedreht, und in diesem Zustande wurde sie todt auf der Kellertreppe gefunden. Von Herrn von Hagemeister ist niemals eine Spur wieder gesehen worden, nur der große Blutfleck an der Zimmerdecke zeigt die Stelle, wo der Teufel sich einen Ausweg mit ihm gesucht. Noch heute sieht man bei anhaltend regnerischem Wetter in der tiefsten Ecke des Wohnzimmers einen feuchten Fleck. F.M.; vgl. Niederh. 2, 16 f. Darnach war der gottlose Mensch ein Pächter. Derselbe sagte eines Tages zu seiner Frau, wenn er fort sei, solle sie mit denselben Pferden und Wagen fahren, womit er jetzt fahre. Darauf kommt ein Mann mit Schimmeln auf den Hof gefahren und fragt nach dem Hausherrn. Als er wieder fort ist, findet man den Hausherrn todt und Blut in seiner Kammer. Die Frau wurde bald darauf auch vom Teufel geholt. =
- (Quelle: Heidearchiv)
Die Bedeutung der Einführung der Dienst- Bauer- und Wirtschafts-Ordnung durch das Forstcollegium
- (Transkription
- Wilfried Steinmüller)