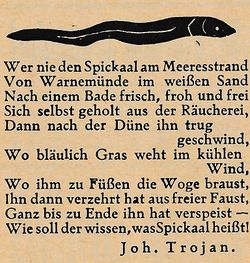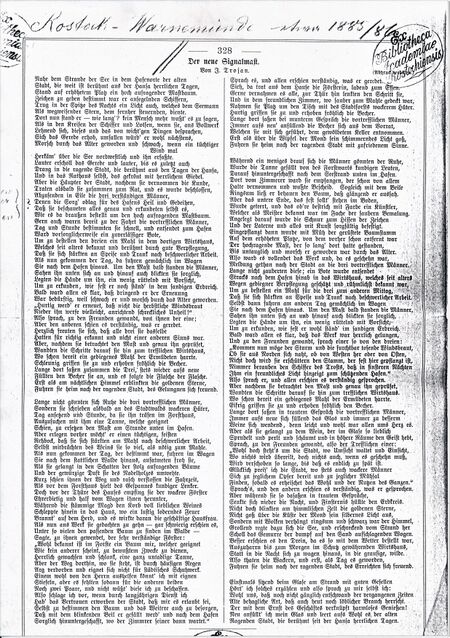Sagen, Geschichten, Legenden, regionale Literatur und Anekdoten zu Warnemünde
Johannes Trojan - der Wahl-Warnemünder hält das hiesige Leben in seinen Erzählungen fest
"Der alte Kirchhof"
Der alte Kirchhof am Strande ist geschlossen seit siebzehn Jahren. Neuerdings ist er auch verschlossen, und wer ihn besuchen will, muß sich an das Mitglied der Gemeinde wenden, das den Schlüssel zur Pforte hat. Dadurch soll verhindert werden, daß die fremden Kinder, die im Sommer hierher kommen, die Blumen von den Gräbern der alten Warnemünder abpflücken, und dagegen läßt sich nichts sagen. Der Kirchhof erhält etwas Eigenartiges durch die Art seiner Grabmäler. Wenige sind von Stein, alle übrigen sind Kreuze und Tafeln von Holz, die das Alter grau gefärbt hat. Davon stehen viele schief, viele sind schon umgebrochen und liegen am Boden zwischen Gras und Kraut, das sie halbschon bedeckt. Viele zusammen sind hie und da überwachsen von dichtem Fliederbuschwerk, aus dem zirpende Vogelstimmchen hervorschallen. An vielen Kreuzen und Tafeln sind die Inschriften nicht mehr zu entziffern. Wo sie noch deutlich sind, findet man oft, daß es ein Schiffer ist, der unter dem Rasen von seinen Seefahrten ausruht. Ueber oder unter der Inschrift auf der Vorderseite ist häufig eine glockenförmige Blume oder ein Schmetterling abgebildet. Die Sprüche auf der Rückseite der Grabmäler sind meist allgemein erbaulichen Inhalts, selten nehmen sie auf das besondere Schicksal des Entschlafenen Bezug, wie der folgende:
„ Von Weib und Kindern früh wegsterben Wie weh das thut, wie schwer das ist! Steh ihnen bei und laß mich erben Die Seligkeit, Herr Jesu Christ!"
Der Mann, welchem dieser Spruch gilt, hieß Fretwurst. Ein sonderbarer Name, der neben dem Namen Bradhering in mecklenburgischen Schifferfamilien häufig vorkommt. Wenige der Gräber, ein paar, die aus der letzten Zeit vor der Schließung des Kirchhofes herstammen, werden noch gepflegt. Alle anderen zusammen hat eine gemeinsame Pflanzenhecke überzogen, aus dem Kirchhof ist eine grüne Wildnis geworden. In dieser Wildnis aber hat der Kampf um das Dasein unter verschiedenen Pflanzen sich abgespielt und spielt sich noch ab. Wo Rosen auf die Gräber gepflanzt waren, hat manchmal der Wildling den echten Stamm, der ihm aufgepfropft war, überwunden und statt des Gartenstrauches steht nun auf dem Grabe, in seiner Fülle blaßroter Blumen nicht weniger schön anzuschauen, ein wilder Rosenstrauch – wie ich dasselbe auch auf alten Berliner Kirchhöfen gesehen habe. Von wurzelechten Rosen haben nicht wenige zwischen Gras und Unkraut sich erhalten, darunter die schöne gewöhnliche Centifolie, die früher, da sie noch albeliebt war, vorzugsweise die „echte Rose" genannt wurde, und die leider auch aus der Mode gekommene so schöne weiße Rose, die Rosa alba. Unter andern angepflanzten Gewächsen, die ihren Platz behauptet haben, fallen besonders die vielen Feuerlilien auf. Dieser Lilien-Art wurde es wohl deshalb nicht so schwer, sich zu behaupten, weil sie auch da, wo sie wild vorkommt, auf Wiesenboden zwischen dem Grase steht. Nelken und Glockenblumen sind noch an einigen Stellen blühend zu finden, doch nur auf Gräbern, die noch nicht sehr alt sind. Einige Grabstätten sind bedeckt mit Salbei, die ich auch mehrfach auf dem neuen Kirchhofe gefunden habe, der eine Viertelstunde von dem alten entfernt hinter den Dünen angelegt ist.
- Sonst ist mir die Salbei als Grabpflanze noch nicht aufgestoßen.
Auf einigen Gräbern steht Spargel. Ob er vor Zeiten ans gepflanzt worden ist, oder ob ihn der Zufall ausgesät hat, weiß ich nicht. Jedenfalls erscheint er um die Zeit, da er in Blüte steht, als ein allerliebstes Zierbäumchen, eine Lärchentanne im Kleinen. Mit großem Erfolge ist aus dem Kampf ums Dasein eine Pflanze hervorgegangen, die ursprünglich vielleicht nur in einem Exemplar vorhanden war, das Seifenkraut oder die Saponaria. Mit ihrem kriechenden Wurzelstock um sich greifend und alles andere Pflanzenvolk verdrängend, hat sie allmählich einen ansehnlichen Teil des Kirchhofes in Besitz genommen und bildet darauf einen geschlossenen Bestand. Die Pflanze ist nicht sehr schön, um ihre Blütezeit aber im Hochsommer nimmt sie sich doch mit ihren fleischroten Blumen, die einen angenehmen Duft verbreiten, gar nicht übel aus. Alles übrige bedeckt hohes Gras und Unkraut, Gebüsch und Gestrüppe. Da wäre für Vögel gut wohnen, wenn sie ungefährdet wären. Wer aber diese kleine Wildnis durch streift, den schauen nicht selten aus dem Grase ein paar funkelnde gelbgrüne Augen an, und wenn er zugeht auf dieselben, springt eine buntscheckige Rasse über die Gräber davon und dem Zaun zu, an dem sie empor fährt. Vogelfängerinnen haben diesen Ort, der so wenig von Menschen betreten wird, zu ihrem Jagdbezirk gemacht. Das ist der alte Warnemünder Kirchhof, der sich selbst überlassen ist. Von Jahr zu Jahr fallen mehr der hölzernen Kreuze und Tafeln um, und einmal wird auch über die letzten das wilde Grün gewachsen sein. Ein Ort des Friedens scheint dieser alte Begräbnisplatz zu sein, ist es aber doch nicht, denn über den Toten wird ein Krieg geführt, leise zwar, aber mit Hartnäckigkeit und ohne Schonung.
"Am Seestrand"
Sie trug sich sehr ordentlich und sauber, die alte Frau, ja, sie war die Ordnung und Sauberkeit selber. Kein Stäubchen entging ihr, und daß irgendetwas stand, lag oder hing, wo nicht sein richtiger Platz war, erschien ihr als ein Verstoß gegen die Weltordnung. Ich glaube, wenn sie solchen verirrten oder verführten Gegenstand nur mit strafendem Blick ansah, verfügte er sich von selbst an die Stelle, die ihm bestimmt war. Ich sehe sie vor mir. Sie war eine hohe, hagere und knochige Gestalt. Aus den kräftigen Zügen ihres Gesichtes sprach ein energisches Wesen. Es lag etwas Strenges darin, aber sie konnte auch sehr freundlich aussehen, und so sah sie immer aus, wenn ich mit ihr redete. Sie war Schiffers-Wittwe und hatte zwei Söhne verloren, als sie im ersten Mannesalter standen. Davon war einer, der auch auf die See ging, mit dem Schiff untergegangen an der Südküste von Afrika, wie es hieß. Gewisses erfuhr sie nicht, denn von dem Schiff kehrte keiner zurück. Bei der alten Frau wohnte ich manchen Sommer, wenn ich allein in dem mecklenburgischen Hafen- und Badeort weilte, in ihrem kleinen Hause, dessen Giebelwand ganz von Epheu kleinblättriger Art übersponnen war. Neben der Hausthür hinter dem Epheu hing der Hausschlüssel, das war ein vollkommen sicherer Aufbewahrungsort für ihn. Vor dem Hause war ein ganz kleiner Vorgarten mit einer Bank und zwei schlanken Rosenstöcken, die bis in den Herbst hinein blühten. Da saß es sich gut in sternheller Nacht, wenn alles so still war, und man den Tau von den Blättern tropfen hörte. Ich hatte unten in dem Häuschen zwei kleine Stuben, die hübsch eingerichtet waren. An den Wänden hingen viele Bilder. Darunter waren der „ Liebesbrief", der Abschied", die wunderbare und erschütternde Geschichte des kühnen Kossakenhetmans Mazeppa, „ Agnes “ mit einer Taube und „ Röschen" mit einem großen Hunde. Dazu viele Photographien, meist Familienbilder und eine ganze Reihe französischer Landschafts- und Trachtenbilder aus der merkwürdigen Gegend von Le Puy. Diese hatte ein Sohn der Witwe, der auch Seefahrer war, aus Frankreich mitgebracht, wohin er als Gefangener geführt worden war, nachdem die Franzosen sein Schiff gekapert hatten. Das war um die Zeit des großen Krieges. An den Fenstern standen Blumentöpfe mit schönen Gewächsen, die prächtig blühten und so sauber und ordentlich gehalten waren wie alles sonst in dem Häuschen. Die alte Frau hauste dann, wenn ich dort wohnte, unten in ihrer schmucken kleinen Küche und in dem Dachstübchen oben, wo sie auch noch die schönsten Blumen hatte. Das Fenster meines Schlafstübchens ging auf den Hof hinaus, und über dem Fenster war ein Schwalbennest. Wenn ich zu früher Stunde aufwachte, blieb ich gern eine Weile wach, um dem lieblichen Gezwitscher der Schwalben zu lauschen. Das zwischendurch aber hörte ich oft die alte Frau schon, wie sie auf dem Hof umherschaltete und sich an dem Brunnen zu schaffen machte. War ich aufgestanden und hatte mich an gekleidet, so schloß ich das Fenster auf, und wir boten uns guten Morgen. Mit irgend einem Geräth in der Hand stand sie dann da, mir freundlich zunickend, und so sehe ich sie vor mir. Mit Aufräumen und Säubern hatte sie täglich zu thun, von Zeit zu Zeit aber veranstaltete sie ein großes Reinmachen, und da schien immer für sie eine Art von Fest zu sein. Wenn dann ihr Küchengerät und Geschirr alles blitzblank und wohlgeordnet auf dem Hof stand, musterte sie es mit Stolz und Freude. Sie war gut eingerichtet und reichlich mit Hausrat versehen, unter dem sich wertvolle Stücke befanden. So besaß sie wunderhübsches blaugemustertes Porzellan, das ihr Mann, der Seefahrer, aus England mitgebracht hatte. Wenn ich bei ihr wohnte, suchte ich gleich allem, was unter ihrer Aufsicht stand, ihre Zufriedenheit zu erwerben. Ich befliß mich peinlichster Ordnungsliebe. Ich ging nicht aus, bevor ich nicht auf dem Tisch alles sauber zusammen gelegt, das Tintenfläschchen zugestöpselt, die Schubladen verschlossen und die gehäkelten kleinen Decken, die so leicht herunter fallen, ordentlich wieder über die Sophalehnen gebreitet hatte. Papierschnipsel ließ ich nicht auf dem Fußboden liegen, sondern sammelte sie sorgfältig auf, und hütete mich sehr, Cigarrenasche hinzustreuen, wohin sie nicht gehörte. Nie ließ ich Westen auf Stühlen, Taschentücher auf Kommoden, Blumen oder Pilze, die ich von draußen mitgebracht hatte, auf der Gartenbank liegen. Meine Morgenschuhe stellte ich immer so hin, daß beide mit ihren Schnäbeln nach Westen sahen. Dem Stiefelknecht wies ich einen Platz an, den er nicht verlassen durfte. Dafür wurde mein Ordnungssinn mehrfach von meiner guten Wirtin gelobt, und ihr Lob erfüllte mich mit Stolz, wenn ich auch das heimliche Bewußtsein hatte, es nicht auf ganz ehrlichem Wege erworben zu haben. Ich ließ mich gern von ihr ein wenig bemuttern. Sie erinnerte mich daran, dass ich das Bad nicht versäumte, dass ich mich ordentlich nährte, und sorgte dafür, dass es mir nie an Spickaal fehlte, den sie aus den besten Quellen zu beziehen wußte. Als ich aber in einem Jahr wieder an den Strand kam, fand ich die alte Frau nicht mehr in ihrem Häuschen. Ich hörte, daß sie schwer krank sei und in ein anderes Haus gezogen, zu Verwandten, bei denen sie Pflege fand. Nun wohnte ich ganz allein in dem kleinen Hause und kam mir wie verwaist vor. Bald merkte ich, daß ich nicht mehr so ordentlich war wie früher. Ich litt es, daß Papier auf dem Fußboden lag, es kam mir nicht darauf an, wie die Morgenschuhe standen, ich ließ den Stiefelknecht sich hinstellen, wo es ihm gefiel. Mit einem Wort, ich fing an zu verwildern. Aber alles war auch nicht mehr in dem Hause, wie es sonst gewesen war. An einem Tage, als ich aus dem Fenster meines Schlafstübchens sah, wurde ich eine große Ratte gewahr, die auf dem Hof umherhuschte und die Küchenabfälle beschnüffelte, welche die Nachbarn dorthin geworfen hatten. Da dachte ich bei mir, die weiß es auch schon, daß die alte Frau fort ist. So lange sie da war, hatte ein solcher Gast hier nichts zu suchen. Täglich erhielt ich schlechtere Nachrichten über die Kranke, und ich glaubte nicht, daß ich sie wiedersehen würde. Ich sah sie aber doch noch einmal. Ich kam aus der Heide, die ziemlich weit von dem Ort entfernt liegt, jenseits des Wassers, das der „Strom“ heißt. Ein paar Tage war ich dort umhergestreift. Als ich mich am Abend über das Wasser setzen ließ, war es schon dunkel. Denn der September hatte angefangen, und die Tage wurden kurz. Wie ich nun die Stromseite entlang ging, um mich zu meinem Häuschen zu begeben, fiel mir eine hell erleuchtete Veranda in die Augen. Ich trat näher und erblickte etwas sehr Überraschendes. Im offenen Hausflur, durch die sonst verhängten Fenster der Veranda allen Vorübergehenden sichtbar, stand ein Sarg mit einer Toten, von vielen brennenden Kerzen umgeben. Sogleich erkannte ich meine alte Wirtin. In ihrem sauberen Totenkleide, die Hände über der Brust gefaltet, lag sie da, im Gesichte den Ausdruck tiefsten Friedens, als ob sie im ruhigsten Schlummer läge. Es ist des Ortes Sitte, daß die Toten in solcher Weise ausgestellt werden die ganze Nacht vor dem Begräbnis. Manchen Badegast, der vorbeiging, um sich zum Abendtrunk zu begeben, mag der Anblick eigentümlich berührt haben. Ein memento mori war es, aber keines von erschreckender Art. Am andern Tage begruben wir die alte Frau, wir betteten sie in den Sand des Strandes. Den Kirchhof, auf dem sie liegt, habe ich im Frühling darauf besucht. Er befindet sich ein Stück entfernt von dem Ort, unmittelbar hinter den Dünen. Dort hat sie ein Grab wie die andern. Es ist kein Hügel, denn der Wind duldet dort keine Hügel, er würde sie bald wegwehen. Es ist ein flaches Beet, von Steinborden eingefasst, die den leichten Boden zusammenhalten sollen. Darauf steht ein Kreuz mit dem Namen der Toten. Frau Seyer hieß sie. Als ich dann auch das Häuschen aufsuchte, in dem ich manchen Sommer gewohnt hatte, fand ich es sehr verändert. Der Epheu war von der Giebelwand heruntergerissen und entfernt, aus dem Gärtchen waren die Rosenstöcke verschwunden und vom Hof das Schwalbennest. Nichts mehr von Blumen war an den Fenstern zu sehen.
"Beim alten Schiffer"
Der Mann, bei dem wir an dem kleinen Standort wohnten, war ein alter Schiffskapitän oder Schiffer, wie man dort sagt. Solcher sind viele daselbst zu finden. Er stand in der Mitte der sechziger Jahre und war kurz und stämmig gebaut, wie es die Seefahrer meist sind, und wie es ja auch für Leute, die auf schwankendem Boden hantiren müssen, der geeignetste Wuchs ist. Daß er manchen Sturm ausgehalten, war ihm anzusehen, aber er war noch rüstig und wacker wie ein alter Apfelbaum. Seit fünfzehn Jahren fuhr er nicht mehr zur See, zufrieden lebte er an dem Orte, wo er geboren war, von dem aus er die See erblicken konnte. Ein alter Schiffer muß etwas Fühlung mit dem Salzwasser behalten, wenn er nicht verkümmern oder eingehen soll. Stellt ihm die Wahl zwischen einem prächtigen Schloß mitten im Binnenlande und einer strohgedeckten Hütte am Strande, so wird er die letztere wählen. Sollte er aber aus Irrtum – auch alte Seeleute irren ja, obwohl nur selten – das Schloß vorziehen, so wette ich hundert gegen eins, dass er es keine vier Wochen darin aushalten wird. In dem Ort aber, wo unser alter Seefahrer sein Lebensschiff vor Anker gelegt hatte, konnte er nicht nur die See erblicken, sondern es fehlte ihm auch nicht an Umgang mit Seinesgleichen. Alte Schiffer gab es, wie schon erwähnt wurde, viele an dem Ort und vorübergehend auch junge. Wenn aber letztere lange auf dem Lande bleiben mußten, so war das ein Zeichen von schlechter Zeit für die Schiffahrt. Mit der Schiffahrt aber steht der ganze Ort in engem Zusammenhange, denn alle seine Bewohner fast sind Miteigner von Schiffen. Es ist ein merkwürdiger Ort dieses Stranddorf, das nicht einmal einen Hafen hat und dabei mehr Seeschiffe besitzt als manche Seehandel treibende Stadt. Unser Wirt gehörte zu den älteren Kapitänen, die sich noch von der guten Zeit her eines behaglichen Wohlstandes erfreuten. Er bewohnte mit seiner Frau ein nettes Haus und hatte bei sich seine Tochter mit einem Kinde. Der Mann der jungen Frau, sein Schwiegersohn, war draußen auf See. „ Jetzt ist er auf der Rückfahrt von Buenos Aires “, sagte der Alte. Nun hatten sie sich für den Sommer auf die oberen Stübchen unter dem Dach zurückgezogen, das ganze Erdgeschoß war uns eingeräumt worden. Wie hübsch waren unten die Zimmer eingerichtet, wie sauber gearbeitet alle Möbel! Man fühlt sich so viel heimischer in einer so sorgfältig eingerichteten Wohnung, als da, wo man nur den lieblos gearbeiteten Kram findet, der allein für den Gebrauch der Fremden zu möglichst billigen Preisen hergestellt ist. Daran erinnerte hier nichts. Ueber die Betten waren schlohweiße Decken von gediegener Arbeit gebreitet. „ So etwas “ , sagte die alte Frau, ,,wird jetzt nicht mehr gemacht. Wie alt sind diese Decken schon, und dabei sind sie unverwüstlich, und schneeweiß bleiben sie auch .“ In jedem der beiden Vorzimmer fand sich eine prächtige Stutzuhr vor, die auch richtig ging. Sogar ein Pianino – ich wäre auch ohne das zufrieden gewesen – war da, und auf demselben standen als Zimmerzierde unter Glasglocken zwei große Sträuße von künstlichen Blumen. Auch die Küche war wohlbestellt mit allem Geräth, das die Hausfrau anzutreffen wünscht. Für den Tischgebrauch war gutes englisches Porzellan, wie man es vielfach in den Häusern alter Schiffskapitäne findet, in Fülle vorhanden. Es konnte einem in der Seele wehtun , wenn etwas davon durch die Hand eines zerstörungslustigen Berliner Mädchens dem Untergang geweiht wurde. In den Keller hab ich nicht hineingesehen, vermuthe aber, daß da auch etwas lag. Von den alten Schiffern ist doch jeder einmal in Spanien gewesen und hat nicht versäumt, sich von dort ein Fäßchen Alicante, Amontillado oder Malaga mitzunehmen . Das hat er, nachdem es während einer Sonnenfinsterniß durch den Zoll gegangen, zu Hause abgezapft und wohl in den Keller verstaut. Ab undzu kommt dann wieder etwas ans Tageslicht, aber nur bei sehr feierlichen Gelegenheiten. In fremden Häusern ist besonders anziehend für mich der Bilderschmuck der Wände. Darunter fand sich auch in dem Hause, von dem die Rede ist, einiges Eigenartige. Manches freilich, was da hing, war der Art, wie es überall von hausierenden Kunsthändlern, teilweise nicht zur Förderung des besseren Geschmackes verbreitet wird. Da gab es eine Schönheit mit wohlklingendem weiblichen Namen darunter, ein Jagdstück und zwei Gemälde, die ,,Venedig am Morgen " und ,,Venedig am Abend darstellten und anscheinend von einem Meister der Düsseldorfer Schule aus der Zeit des tiefsten Verfalls derselben herrührten. Außerdem aber zierten die Wände zahlreich in Oel gemalte Abbildungen von Schiffen, und zwar von wirklichen Schiffen, also Schiffsportraits. Natürlich stellten sie Schiffe dar, die von dem Kapitän selbst oder von seinen Verwandten und Freunden gefahren waren, wie sich denn auch aus den Unterschriften erkennen ließ. Es muß einmal eine Schule von Marinemalern gegeben haben, die eigens für Schiffskapitäne dergleichen Bilder anfertigte. Solche Künstler giebt es wahrscheinlich noch heute, doch fürchte ich, dass sie in Folge des Niedergangs der Segelschiffahrt in ihren Erwerbsverhältnissen stark zurückgekommen sind. Vor fünfundzwanzig Jahren aber muß ihre Kunst noch sehr geblüht haben. Es ist ja selbstverständlich, dass sie keine Unsummen für ihre Bilder erhielten und dass keine Meisterwerke von ihnen erwartet wurden, aber das ist gewiß von ihnen verlangt worden, dass alles richtig war an der Takelage, und dass nicht zu gleicher Zeit verschiedene Winde in die Segel bliesen. Die Bilder sind alle ziemlich gleichartig angelegt. Im Vordergrunde befindet sich das Schiff, eine stolze Brigg, die bei frischer Brise über die lebhaft bewegte See hinfliegt. Alles Leintuch an Bord ist aufgespannt, höchstens ein oder das andere Segel gerefft. In einiger Entfernung sieht man zuweilen auf demselben Bilde dasselbe Schiff noch einmal dargestellt, wie es im Wenden begriffen ist. Als Staffage zeigt sich im Hintergrunde eine Küste mit einem Leuchtturm oder ein Felsen, auf dem ein vieltürmiges Schloß sich erhebt. Manchmal ist auch der Ort, wo sich gerade das Schiff befindet, genau bezeichnet. So lautet eines Bildes Unterschrift: „Isabella von Wustrow, Kapitän Zeplien, 1868 beim Texel", und in der Ferne erblickt man richtig den Texel in naturgetreuer Abbildung. Auf jedem der Bilder ist das Datum der Fahrt, auf der das Schiff begriffen ist, und der Name des Kapitäns angebracht. Der Schiffer liebt sein Schiff, er hängt mit dem Herzen daran. Der Besitz eines Schiffes, die Ehre, Kapitän desselben zu sein, wird sehr hochgeschätzt. Davon zeugt die eigentümliche Sitte, daß eine Schifferfrau ihrem eigenen Namen den des Schiffes, welches ihr Ehemann fährt, als nähere Bezeichnung hinzufügt. Da ist eine Frau Jörck, deren Mann ein Schiff Namens „ Gustav Meßler“ führt, sie nennt sich ,, Frau Jörck, Schiff Gustav Meßler“. Das ist bezeichnend für einen Ort, der ganz auf Schiffahrt gegründet ist. Vor dem Hause war an der Straße, durch ein Zäunchen von ihr getrennt, ein Platz mit einer Laube, in der man Schutz vor Sonne und mäßigem Regen fand, und mit einem paar hochstämmiger Rosenbäume, die den ganzen Sommer hindurch blühten. Eine kleine Pforte führte gerade auf die Haustür zu. Zu beiden Seiten derselben stand am Hause eine Bank, recht gemacht, um da bei Sonnenuntergang, wenn die Schwalben ihr Abendliedchen zwitscherten, gemütlich zu sitzen und eine Pfeife zu rauchen. Natürlich rauchte unser alter Herr auch, wie alle Schiffer, und rauchte immer. „Rauchen thu ich für mein Leben gern“, sagte er eines Tages zu mir, als er die geliebte Pfeife hatte wegstellen müssen , weil er beim Heumachen auf der Wiese sich erkältet hatte. Gott sei Dank, am andern Tage rauchte er schon wieder, als er früh am Morgen in Hemdsärmeln seinen Garten musterte. Der lag hinter dem Hause und war sehr geräumig. Der vordere Theil war als Blumengarten eingerichtet und enthielt vielerlei Blühendes. Die Seeluft scheint manchen Gewächsen besonders förderlich zu sein, so den weißen Lilien, die in den Gärten der Stranddörfer außerordentlich üppig blühen, und auch den Rosen bekommt sie gut. Die Beete im Garten unseres Wirthes waren alle schön bepflanzt und teils mit Buchsbaum eingefaßt, der sorgfältig unter der Schere gehalten war, theils mit Jehova- oder Porzellanblümchen, wie sie in meiner Heimat heißen. Nicht das kleinste Unkraut war auf den Beeten zu sehen, und die Steige zwischen ihnen wurden immer aufs Neue sauber geharkt. Hinter dem Blumenstück lag der Nußgarten, wohlbestellt mit allerhand Gemüsen und Küchenkräutern. Dazwischen standen Fruchtbäume verschiedener Art, und der breite Mittelsteig war auf beiden Seiten eingefaßt von Stachelbeerbüschen, von denen eine hübsche Anzahl, als die Beeren reif geworden waren, meinen Kindern zur Plünderung überlassen wurde. Das war ein Fest, das sich durch mehrere Tage hinzog, und als alles schon abgeerntet erschien, fanden sich immer noch versteckte Früchtchen. Unser Hauswirt war auch ein bischen Landmann. Er hatte draußen vor dem Dorf ein paar Stücke Roggen und Kartoffeln, einen Kleeacker und eine Wiese. Er hielt eine Kuh und machte alljährlich ein Schwein fett. Das diesjährige Hausschwein war ein treffliches Exemplar, ein Musterbild seiner Gattung. Zu Anfang August schon zeigte es sich so dick und rund, daß wir es nicht genug bewundern konnten. Ich mutmaße, daß es um die Zeit, da das Schlachten stattfindet, einen fast übernatürlichen Umfang erreicht haben wird. Freilich soll auch ein solches Tier den Hausstand während des ganzen Jahres mit Fleisch und Speck versorgen, und das ist selbst für ein ansehnliches Schwein, das sich mit der größten Hingebung mästet, keine ganz kleine Aufgabe. So hatte unser Hauswirt, wenn er nach allem sehen wollte, genug zu tun. Er hatte aber ein Auge auf alles, weshalb ihm auch alles gedieh. Früh am Morgen schon war er auf. Nachdem er dann seinen Garten inspiziert und festgestellt hatte, woher der Wind wehte, machte er einen kleinen Spaziergang längs des Strandes an dem großen Deich hin, aber nur wenige hundert Schritte weit, bis zu der Stelle, wo vor Jahren einmal die See durchgebrochen ist. Da ist von dem Durchbruch her ein Pfuhl zurückgeblieben, zum Teil mit Binsen und Schilfgras bewachsen. Den sah er sich nachdenklich an und kehrte dann langsam wieder nach Hause zurück. Bei dieser Gelegenheit überzeugte er sich auch davon, ob Fischerboote auf der See waren. Wenn gefischt wurde, konnte man von ihm hören, was für Chancen der Flunderfang habe, wann die Boote zurückkehren würden und man an den Strand gehen müßte, um einen Einkauf zu machen. Auch besorgte er selbst wohl den Einkauf. Man muß überhaupt nicht denken, daß die alten Schiffer dort nichts zu tun hätten. Zweimal am Tage halten sie Börse ab, wie sie es nennen, einmal am Morgen auf einer Bank bei der Strandstraße, zum zweiten Mal Abends auf einer anderen Bank am Binnenwasser bei der Kirche. Da sitzen sie und besprechen die Welthändel, die Angelegenheiten der Schiffahrt und was für sie sonst von Bedeutung ist. Manchmal steht einer von ihnen auf und geht ein Weilchen hin und her, aber stets nur fünf Schritt hin und fünf Schritt zurück, denn ,,breiter is de Bord nich.“ Gewöhnlich hat jeder von ihnen ein Messer in der Hand, mit dem er an der Bank schnitzelt. Das ist Gewohnheit vom Bord her, ein Seemann muß immer etwas in der Hand haben, womit er sich zu schaffen macht. Einmal ist eine der Bänke der Vogt glaube ich, kam auf den Gedanken ringsum an den Rändern mit Eisen beschlagen worden, aber das half nicht viel, denn sie schnitzelten mitten in den Sitz hinein. Setzt sich ein Fremder zu ihnen, um zu hören, worüber sie sprechen, und mit zu plaudern, so erhebt sich zuerst der am weitesten von dem Fremden entfernt Sitzende ganz sacht und schleicht sich davon. Ihm folgt der zweite, diesem der dritte, und es dauert nicht lange, so sitzt der Fremdling ganz allein auf der Bank. Dieser Handlungsweise liegt keine Unfreundlichkeit auf Seiten der alten Männer zu Grunde, nein, nichts als eine gewisse Scheu, in Gegenwart Fremder über ihre Angelegenheiten zu reden. So werden Kinder, die sich etwas erzählen, still, wenn ein Erwachsener hinzukommt. Das ist die Morgen- und die Abendbörse. Außerdem kommt ein Teil der Alten Nachmittags um vier Uhr in dem einen Wirthshaus zusammen, wo einige Blätter aufliegen, ein Handelsblatt darunter. Eine halbe Stunde wird in die Zeitungen hineingesehen, dann geht es ans Kartenspiel. Ich glaube, daß früher ,,Klabberjas" oder sonst eines der alten landesüblichen Kartenspiele üblich gewesen ist, jetzt herrscht auch hier am Strande und unter diesen Leuten allein der Skat. Auch das Spiel hat seine bestimmte Zeit, bevor es sieben schlägt, sind alle Einheimischen aus der Gaststube verschwunden. Ich fürchte sehr, daß es mit den alten Schiffskapitänen geht, wie es vor langer Zeit schon den Eibenbäumen ergangen ist und wie es jetzt über die italienischen Pappeln kommt, dass sie anfangen auszusterben. Bei der rapiden Abnahme der Segelschiffahrt ist es ja kein Wunder, daß ihrer immer weniger werden. Der Tod räumt auch auf unter ihnen. Sechs oder sieben Mal in den wenigen Wochen ich weiß nicht genau wie oft - verkündete in dem Stranddorf, von dem ich rede, die so eindringlich mahnende und so zu Herzen gehende Stimme der Glocke, daß wieder einer der Alten gestorben sei. Am dritten Tage darauf wurde er dann beerdigt. Voran ging der Lehrer des Ortes mit den Schulkindern, die ein Grablied sangen, dann kam der Wagen mit dem Sarg, ihm folgten, vom Pastor geführt, die Männer in ihrem Sonntagsanzug, wie sie zur Kirche gehen, die Frauen und Mädchen alle in schwarzen Kleidern und mit schneeweißen Kopftüchern angetan. Als eben wieder einmal ein alter Schiffer gestorben war, fuhr in der Ferne Angesichts des Ortes ein Schiff mit vollen Segeln vorüber. Einige, die am Strande standen, erkannten es und sagten, auf den Toten hindeutend, der noch unbestattet in seinem Hause lag: „Das Schiff fährt sein Sohn. Der weiß noch von nichts und fährt so in die weite Welt hinein.“ Einige sagen: Die Segelschiffahrt wird wieder in die Höhe kommen, wenn es mit den Kohlen zu Ende geht, und die Kohlen halten nicht ewig vor. Nun, das mag fein, falls nicht ein anderes Ersatzmittel der Dampfkraft, etwa die Elektrizität, bis dahin bei Seeschiffen in Gebrauch kommt – das mag sein, aber erleben werden wir's nicht, es sind vorläufig noch gar zu viel Kohlen da. So bleibt denn für mich und andere, die auch die alte Art gern haben, nur der etwas eigennützige Trost, daß, so lange wir leben, immer noch ein kleiner Bestand davon vorhanden sein wird .
"Der neue Signalmast"
"Findigkeit der Hunde"
- Von der Findigkeit der Hunde will ich ein rührendes Beispiel erzählen.
Im Seebade Warnemünde wurde ein grosses Bade- und Volksfest gefeiert, und der Landesfürst selbst nahm daran Theil. Natürlich strömte in Warnemünde ein grosses Publikum zusammen, und besonders aus der nahe gelegenen Hafenstadt Rostock kamen so viele Tausende, als nur irgend aus einer mittelgrossen Stadt, in der Wohlfahrt, Vergnügungstrieb und gute Gesundheitszustände herrschen, herausströmen können. Von Rostock nach Warnemünde brauchen die Dampfschiffe, die auf dem breiten Fluss den Verkehr zwischen den beiden Orten vermitteln, zur Zurücklegung der Fahrt eine Stunde, der Landweg aber beträgt beinahe Meilen. Der Festtag erschien, und voll bis zum Sinken kam vom frühen Morgen an Dampfschiff auf Dampfschiff nach Warnemünde. Es war eine unzählbare Menge, die auf dem Festplatz sich drängte, das Fest aber war über die Massen schön. Da es sich nun zum Ende neigte und es dunkel ward, bemächtigte sich des Publikums eine grosse Furcht, es könnte am Ende nicht mehr mit den Schiffen mitkommen, die nach Rostock zurückfuhren. Alles stürzte dem Wasser zu, wo die Schiffe lagen, und dieselben waren im Nu überfüllt. Die aber voll waren, fuhren ab. Bei dieser Ueberstürzung wurde eine grosse Anzahl von Hunden, die ihren Herren aus Rostock gefolgt waren, vergessen und blieb in Warnemünde zurück. Ihre Zahl soll mehrere Hunderte betragen haben. Diese haben dann laut heulend bis tief in die Nacht hinein, ja bis gegen den Morgen hin am Ufer gestanden, und durch ihren Jammer um ihre treulosen Herren ist manch Bewohner von Warnemünde im Schlafe gestört worden. Endlich aber, scheint es, haben sie Berathung gehalten und einen Beschluss gefasst. Sie sind wenigstens um den ersten Hahnenschrei aufgebrochen und in geschlossenem Haufen auf der Chaussee nach Rostock abmarschirt. Die Kleinsten und die schon müde waren, nahmen sie in die Mitte; die Wegkundigsten führten, eine zuverlässige Nachhut sorgte dafür, dass keiner zurückblieb. Das alles weiss man, weil ein später oder vielmehr früher Wanderer in der Morgendämmerung dem Zuge auf der Landstrasse begegnet ist und darüber berichtet hat. Er hat auch die Hunde gezählt und gefunden, dass es 279 waren, und alle Racen waren darunter vertreten. Es sei ihm aber, sagt er, beim dem Anblick eiskalt über den Rücken gelaufen, denn er habe das Ganze für einen höllischen Spuk gehalten. Viele der Hunde hätten gar zu geisterhaft ausgesehen. Was das Letztere betrifft, so ist das kein Wunder, da die Hunde lange Zeit nichts gefressen hatten und in Sorge um ihre Herren waren. Dass es aber kein Spuk war, erwies der andere Tag. Da fand jedweder Bürger von Rostock, der am Tage vorher seinen Hund in Warnemünde vergessen hatte, denselben richtig vor seiner Hausthüre wieder vor. Das ist ein Beispiel von der Findigkeit und zugleich von der Treue der Hunde. Wie viele Menschen hätten denn unter ähnlichen Umständen gleich richtig gehandelt?
- (Auszug aus - Johannes Trojan, "Das Wustrower Königsschiessen und andere Humoresken" - Kapitel 9) (NHG)
Das Zischen - Aus heißen Tagen am Seestrand
- (Aus
- "Johannes Trojan - Auswahl aus seinen Schriften" S.102 o.J.)
- Was hör´ich schallen vom Strande,
- Was ist das was so zischt?
- Das muß der dicke Schulze sein,
- Der sich durch ein Bad erfrischt.
- Er hat sich heiß gelegen
- Am Strand in der Sonnenglut,
- Nun einem glühenden Bolzen gleich
- Wirft er sich in die Flut.
- Da zischt es auf, als wären
- Elftausend Nattern drin,
- Die Flundern reißen aus und fliehn
- Rasch gegen den Nordpol hin.
- Die See fängt an zu kochen
- Und hoch aufspritzt der Gischt.
- So hat es, seit die Welt besteht,
- Noch keine dreimal gezischt.
Wilhelm Dabelstein, ein vergessener Autor und die „Schlacht im Breitling“
- Mit Dabelsteins Tod starb das einzigartige, unverwechselbare Warnemünder Platt aus.
- Viele dieser kleinen literarischen Kabinettstücke fielen der Vergessenheit anheim und harren der Wiederentdeckung da sie doch auf die eine oder andere Art, oft unbemerkt, bis in unsere Tage nachwirken.
- Ein Beispiel dafür ist der Warnemünder Wilhelm Dabelstein, der vor gut einem Jahrhundert die hier Lebenden mit seinem, in typischem Warnemünder Platt verfassten, Erzählungen zum schmunzeln brachte.
- Über die Person Dabelsteins sind auf uns kaum noch Informationen gekommen.
- Selbst ein Foto o.ä. ließ sich von ihm bislang nicht finden. Nur vereinzelte Anmerkungen in seinen Erzählungen lassen Rückschlüsse auf sein Warnemünder Dasein zu.
- Der Name Dabelstein taucht gelegentlich als Signatur bei Gemälden mit Warnemünder Sujets auf (Eines davon im Heimatmuseum), die aber mit hoher Warscheinlichkeit von einem anderen Familienmitglied gleichen Nachnamens stammen.
- Einer der Gründe dafür, das Dabelsteins kleine Literaturkabinettstückchen heute weitgehend vergessen sind, nennt uns Richard Wossidlo:
- „.. man führt gewisse Eigentümlichkeiten der vom übrigen Plattdeutschen stark abweichenden Mundart der Warnemünder, der „Warneminner Liet“, auf vermutete skandinavische Ursprungsbesiedlung und deren Mischung mit dem niederdeutschen zurück.“
- Die Eigentümlichkeit des hiesigen Dialektes war oft selbst für die „Plattdeutschen“ aus der Nachbarregion schwer verständlich. :So widmeten sich Dabelsteins unterhaltsamen Satiren eben fast ausschließlich einer Warnemünder Leserschaft. Unter ihnen wirken sie unbewußt bis in unsere Tage nach.
- Nachfolgendes Dabelsteinsches Zitat mag das unterstreichen:
- „Wat´n richtigen Warminner is, de is up de Rostocker in´n Allgemeinen nich alltau god tau spräken, un wenn dit etwa´n Rostocker unner de Ogen kümmt, so kann ick em nich helpen. Nich blot , dat se uns in de letzt Tid up dat ganze Nurden- und Nurdwesten–Enn´ de Swin verbaden hewwen, so dat de Urt nu indelt ward in en „feines Viertel“ un en „Schweineviertel“ (wo tom bispill ik de Ehr heww in tau wahnen), ne dat is ok all in olle un öllste Tiden so west, dat se ümmer versöcht hemmen uns tau dükern.“
- Und so beschreibt er das Warnemünder Leben das er selbst tagtäglich erlebt.
- Nachfolgendes Beispiel soll davon zeugen.
- Zunächst versucht, die folgende Erzählung hier im Original-Dialekt anzufügen, habe ich mich schließlich dazu entschlossen sie für „Berliners“ und sonstige Zugereiste lieber hochdeutsch nachzuerzählen und dann jeweils die plattdeutsche Originalversion folgen zu lassen, da selbst ältest eingesessene Warnemünder diesen seit knapp hundert Jahren ausgestorbenen prägnant eigenen Dialekt nicht mehr schreiben, sprechen oder lesen können.
Die Seeschlacht auf dem Breitling
Wilhelm Dabelstein 1909 (hochdeutsch nacherzählt)
Es sind noch eine ganze Reihe Leute hier, die sich an die Ereignisse aus ihrer Jugendzeit erinnern. Da durfte in Warnemünde kein Bäcker und kein Schlachter sein, um den Rostocker Bäckern und Schlachtern ihren Verdienst nicht streitig zu machen. Manche der Alten entsinnen sich, das sie im Winter mit Schlitten oft über das Eis der Warnow das Brot für die Einwohner aus Rostock geholt haben um sich einen Schilling zu verdienen. Und das jetzige Geschäft des Schlachters G. von seinem Vater begründet worden ist, indem der damals jeden Sonnabend mit einem Wagen voll Fleisch aus Kröpelin kam und am Rostocker Ende anhielt, wo sich die Warnemünder Frauen heimlich Fleisch holten. Selbst backen durften sie. Der Gemeindebackofen stand am Rostocker Ende. Das Backen ging umschichtig und vorher musste das sogenannte „Backelgeld“ bezahlt werden, was mit dem „Schulholzgeld“, „Wach- und Leuchtegeld“ und ich weiß nicht noch was, die Warnemünder Steuern ausmachte. Was auch heutigentags noch Einwohner die zu den „Eximierten“ („von Lasten Befreiten“) gehören, bezahlen müssen. Auch wenn inzwischen die Backerei aufgehört hat und jeder sein Brot kaufen kann wo er will. So wie mit den Bäckern und Schlachtern war es auch noch mit anderen Sachen. So zum Beispiel durfte kein Warnemünder Schiffer ein Schiff fahren, das in Rostock vom Stapel gelaufen war, ausgenommen er war Rostocker Bürger geworden und bezahlte Rostocker Steuern. Einmal soll es doch vorgekommen sein, das ein Warnemünder Kapitän, ohne diese Bedingung zu erfüllen, mit einem neuen Rostocker Schiff ausgelaufen ist, das auch noch in Rostock gebaut worden war. Als er dann von großer Reise mit einer Ladung Bordeaux-Wein wieder hier angekommen war, und mit seinem Schiff im Pinnengraben lag, wo damals eben die großen Schiffe lagen. Die Warnow wie heute war zu jener Zeit noch nicht vorhanden. Da wollten ihm die Rostocker das Ruder von seinem Schiff abnehmen, damit er nicht wieder auslaufen könne. Beim ersten Versuch ließen die Warnemünder sie nicht an Bord. Aber als dann in den folgenden Tagen ein steifer Südost wehte, kamen dann die Rostocker mit ihren flachen Leichtern gesegelt, mit denen sie sonst das Korn von Rostock zu den großen Schiffen auf der Warnemünder Reede brachten. Sie hatten so viele Mannschaften an Bord, das der Warnemünder Kapitän nun nicht mehr entkommen konnte und aufgab. So verlor er schließlich sein Ruder. Nach derartigem Ärger siedelte er sich nun in Ribnitz an und handelte zukünftig von dort aus. Es muß aber auch erwähnt werden, das die Warnemünde sich oft nicht an die „Rostocker Ordnung“ hielten. So zum Beispiel konnten sie es immer nicht lassen, auf dem Breitling wo doch einzig das Revier der Rostocker Fischer war, nicht blos im Winter Aal zu stechen, sondern auch, was noch schlimmer ist mit der Aalharke zu segeln. Einmal sind sie gerade bei dieser Fischräuberei, da sehen sie wie ein halbes dutzend Rostocker Fischer die Warnow herunter gesegelt kommt. Die Rostocker waren bereits an der Eck von Groß-Klein der „Pogg“ (Frosch) genannt wurde, wegen der großen Steine die dort dicht am Ufer im Schilf lagen. Viel Zeit war also nicht mehr, aber den meisten Warnemündern gelang es doch noch durch den Pinnengraben zu rutschen und den Rostockern auszureißen. Nur Einer war so weit flussaufwärts, dass er vor den Rostockern nicht mehr wegsegeln konnte. Er schmiss also sein verbotenes Fanggeschirr über Bord und segelt was die Jolle hergiebt an das hinterste nordöstliche Ende des Breitlings, und zum Ort „ful Water“ (faules Wasser) an Land. Mit einem großen Ballaststein den er im Boot hatte schlug er ein Loch in den Boden der Jolle, so dass sie kein Wasser mehr halten konnte. Seine Sachen zusammenraffend flieht er unerkannt über die Düne gen Heimat.Eine Nummer wie heute brauchten die Jollen damals nicht zu haben, und als die Rostocker herankamen, war von ihnen nicht heraus zu finden wem das Boot gehört. Mitnehmen konnten sie Sie wegen des Loches im Boden aber auch nicht. Am anderen Morgen kamen sie wieder, hatten sich Säcke und anderes Material mitgebracht, womit sie die Jolle abdichteten. Das Bemühen war nun, die Jolle ins Schlepptau zu nehmen und sie nach Rostock zu bringen. Der heutige Damm auf der Ostseite des Stromes existierte damals noch nicht und man konnte von Warnemünde über den ganzen Breitling hinwegschauen. Die Warnemünder hatten natürlich mit dem Fernrohr das ganze Treiben der Rostocker mit angesehen. Als nun die Rostocker absegeln wollten, hieß es hier:“ Was Jungs, wollen wir uns die Jolle wegnehmen lassen ? Nee, das lassen wir uns nicht gefallen, schnell in die Boote und den Rostockern nach !“ Nun wurden flink zwei Jollen, in jeder sieben Mann, parat gestellt und „full Stiem“ hinter den Rostockern her, die mit einer Jolle im Schlepptau nicht so flink vorwärts kamen. Sie hatten sie, noch auf dem Breitling, auch bald eingeholt. Nun an jeder Seite der Rostocker Jolle ein Warnemünder Boot längsseits, rufen sie den Rostockern zu: „Gebt die Jolle raus ! Wollt ihr wohl die Jolle rausgeben? Gebt sie gutwillig raus!“ Die Rostocker sagten gar nichts. Die Warnemünder, die sich die Gesichter mit Schlick eingeschmiert hatten und die Jacken verkehrt herum angezogen hatten, gingen nun mit den Riemen auf die Rostocker los. Die Rostocker, unter denen auch zwei Polizisten waren, verkrochen sich vor Angst unter den Duchten. Einer der Warnemünder schnitt während des Gefechtes den Schlepptampen womit die Jolle fest war, mit dem Messer ab und stracks hauten sie mit ihrer Jolle ab. Das war nun eine böse Geschichte und von Rostocker Seite musste das ein Nachspiel haben. Aber als man die Warnemünder Fischer in die Stadt vor Richter und Rat vorlud verriet keiner den Anderen. Die Rostocker Fischer, konnten keinen der vorgeladenen Fischer wieder erkennen. Sie antworteten immer wenn sie gefragt wurden ob es Dieser oder Jener gewesen sei: „Mag sein.“ Bis zuletzt die Rostocker Beamten die Kerls laufen ließen. Es wäre wohl auch nicht rausgekommen, wenn nicht zuletzt die Geschwätzigkeit des weiblichen Geschlechtes dazu gekommen wäre. Die Warnemünder Fischfrauen fuhren damals jeden Morgen, mit einer Jolle zum Markt. Sie ruderten sich selbst und segelten ebenso forsch wie die Männer. So kamen sie einmal Mittags mit ihrer Jolle von Rostock zurück und ruderten immer am Schilf des westlichen Ufers entlang. Die Rostocker Fischer hatten aber nun die Gewohnheit zur Mittagszeit ihren Kahn ins Schilf zu ziehen, ihr Butterbrot zu verzehren und ein Auge voll zu nehmen. So ein Rostocker liegt nun auch im Schilf als die Frauen vorbeiziehen. Und weil die Frauen nun einmal den Mund nicht halten können, so hört er, wie sie sich über diese Geschichte erzählen: „Und das ist doch noch einmal gut gegangen, das sie Karl S. und Heiner B. nicht gekriegt haben ! Und Albert H. ist auch dabei gewesen !“ Und so weiter und so weiter. Na, das war nun was für den Fischer, er schreibt sich die Namen mit Kreide auf die Planken des Bootes, und so mussten die, deren Namen offenbar geworden waren am Ende doch noch dran glauben. Ich meine sie mussten sogar noch einsitzen. Das war das Ende der Seeschlacht im Breitling, zwischen den Warnemündern und den Rostockern. Darum sind sie den Rostockern heut noch nicht ganz grün, und sollte ein Rostocker in den Strom fallen, dann will ich hoffen das sie ihn wieder heraus fischen und nicht etwa rufen: Schmeiß den Teufel in den Strom! Er ist ein Rostocker! Lass ihn treiben!“
"De Seeslacht up´n Breitling" von Wilhelm Dabelstein im Original Warnemünder Platt 1909
Wat´n richtigen Warminner (die ortsübliche Aussprache; lautet fast wie „Wärminner“) is, de is up de Rostocker in´n Allgemeinen nich alltau god tau spräken, un wenn dit etwa´n Rostocker unner de Ogen kümmt, so kann ick em nich helpen - nich blot, dat se uns in de letzt Tid up dat ganze Nurden- und Nurdwesten-Enn´de Swin verbaden hewwen, so dat de Urt nu indelt ward in en „feines Viertel“ und in en „Schweineviertel“ (wo tom Bispill ik de Ehr heww in tau wahnen), ne dat is ok all in olle un öllste Tiden so west, dat se ümmer versöcht hemmen uns tau dükern. So is dat noch gornich so lang her , - t´sünd noch nooch oll Lüd hier, de sik dat ut ehr Jugendtid tau erinnern weten - dat hir in Warminn keen Bäcker un keen Slachter sin dörft, üm dormit de Rostocker Slachters un Bäckers de Verdeinst nich verdragen würd, un männigein von de ollen Lüd weit sik noch recht gaud tau entsinnen, dat he in´n Winter männigmal mit´n Släden up dat Is von de Warnow för de Inwahners Brot von Rostock halt hett, üm sik dormit n´Schilling tau verdeinen , un den jetzigen Slachter G. sin Geschäft is von sin´n Vadder begrünnt worn, de dunnmals jeden Sünnabend mit´n Wagen vull Fleesch von Kröplin na Warminn´keem un an´n Rostocker Enn´n´, stillhöll, wo denn de Warminner frugens so gewissermaßen heemlich sick ehr Fleesch halen deden. Sülwst backen dürften sei. Dei Gemeinde-Backaben stünn up dat Rostocker Enn´, dat Backen güng üm un dorvör müsst denn dat sogenannte Backelgeld betalt warden, wat mit dat „Schulholzgeld“, „Wach- und Leuchtegeld“, un ik weit nich wat noch all süs, de Warminneer Stüern utmaken ded un wat noch hütigendachs, wenn ik mi irren dauh, noch von weck Inwahners , de tau de sogenannten „Eximierten“ gehüren, betalt warden möt, obglik natürlich dese öffentliche Backeri uphürt hett un sick jeder sin Brot köpen kann wo hei will. So as mit de Bäckers un Slachters wir dat uk mit anner Saken. So taum Bispill dörwte keen Warminner Schipper een Schipp fohren, wat in Rostock von´n Stapel lapen wir, utgenamen hei wir Rostocker Börger worden un betalte sin Rostocker Stüern. Na eenmal sall dat doch vörkamen sin, dat een Warminner Kaptein, ahn disse Bedingungen tau erfüllen, mit een niges Schipp utlopen is, wat in Rostock bugt wir, un as hei dunn wedder binnen keem mit ne Ladung Wien von Burdeaux, un mit sin Schipp in´n Pinnengraben leeg, wo dunntaumals de groten Schäpen liggen deden, denn de Warnow was dunn noch nich vörhanden, dunn wullen em de Rostocker dat Rauder von sin Schipp wegnehmen, dat hei nich wedder utlopen künn. Na, dat irste Mal leeten de Warminner sei nich an Burd, äver as dunn in de negsten Dag n´stieven Südost weigen ded, dunn kemen de Rostocker mit de flachen Leichters, wo se dunn dat Kurn von Rostock mit up dei Warminner Reid bröchten för de groten Schäpen,vör de Wind den Strom dal un hadden soveel Mannschaften ünner Deck von ehr Fohrtüge, dat de Warminner Kaptein , de sick sowat nich vermauden was, ehr nich mihr utwutschen künn un nolens volens sin Rauder hergäwen müsst. Na tau verwunnern is dat nich, wenn ünner sönne Molesten wecke Kapteins dat vörtröken, sik in Ribnitz indragen tau laten un von dor ut as Heimathaben tau fohren. Nal up dei anner Sid möt äwerst uk seggt warden, dat de Warminner sick mänigmal nich in son´n Ordnung fügen wullen, de sin möt. So taum Bispill künnen sei dat ümmer nich laten, up´n Breitling, wat doch de Rostocker Fischers ehr Rabeit wir, nich blot Winters Aal tau stäken - ick weit nich ob´t nich hütigendags noch vörkümmt - sondern ok, wat noch slimmer is, mit de Aalhark Aal tau segeln. Na eenmal sünd sei ok wedder grad bi disse Fischröwerie, dunn seihnsei mit eenmal, wi ´ne ganze Haud Rostocker Fischers de Warnow dal up sei los gesegelt kamen. De Rostocker wirn all bi de Eck grad gegenäwer Groten-klein , wat se de „Pogg“ näumen dohnvon wegen den groten Stehen, de dor dicht an´t Aeuwer in dat Reid liggen deiht un wo dei Grotenkleiner, wenn sei äwer de Warnow segeln, anleggen dauhn - vel Tid wihr also nich mihr, äwer dei meisten von de Warminner gelüng dat doch noch , dörch den Pinnengraben tau wutschen un dei Rostocker uttariten. Blot de ein - un von den sin Sähn sinen Swiegersähn heww ik mi dat vertellen laten - wir so wid ruppe, dat hei nich mihr vör de Rostocker vörweg segeln kunn. Hei smet also sin verbaden Geschirr äwer Burd un segelt, all wat de Smack hollen wull, vör´n Wind up dat büdelste En´n von´n Breitling tau, wat sei „ful Wader“ näumen dauhn, löpt hier in de Rönn, wo eben noch Wader naug is för´ne Jöll, so hoch as´t geiht, up Land, smit mit einen von de groten Ballaststeen, de hei in sin Jöll hett, ein grotes lock in den Bodden, sodat de Jöll keen Wader mir hollen kann, nimmt sin Säbensacken un makt sick äwer de Wisch un äwer de Dün ut´n Stow na Hus. Na, ne Nummer as hüt brukten de Jöllen dunnmals noch nich tau hemmen un as de Rostocker rannekemen, künnen sei nich weiten, wen de Jöll tauhüren deid, un mitnehmen künnen sei se ok nich wegen dat Lock in´n Bodden. Se kemen äwern annern Morgen wedder un hadden sik Säck un anner Material mitbröcht, womit sei de Jöll dicht´ten un sei dunn in Släptau nehmen, üm sei nah Rostock tau bringen. Die Damm up die Ostsied vo´n Strom, die dor jetzt is, wir dunnmals noch nich, un man künn von Warminn äwer´n ganzen Breitling wegkiken. De Warnminner hadden natürlich mit´n Kieker de ganzen Marjenzen von de Rostocker mit anseihn. As nu de Rostocker mit de Jöll awsegeln, dunn heit dat : „Wat Jungs ! will´w uns de Jöll wegnehmen laten ?“ „Ne, dat lat´w uns nich gefallen, flink in´ne Boot un de Rostocker nah !“ - Na, also ok flink twei Jöllen prat, in jeder 7 Mann un full Stiem achter de Rostocker her, de man in een Jöll wir´n un mit de anner in´n Släptau nich so flink vörwarts kemen. Se hadden sei ok bald up´n Breitling tau faten un an jeder Sid von de Rostocker en Warminner Jöll raupen sei de Rostocker tau: “Gewt de Jöll rut ! Willt Ji de Jöll rutgeben ? Wi fragen Jug, ob Ji de Jöll gaudwillig rutgäben willt ?“ De Rostocker seggen gornix, äwer dunn de Warminner, de sick de Gesichter mit Mad, de se mit de Reems ut´n Grund halt hemmen, insmeert un sick de Jacken verkihrt antreckt hadden, up de Rostocker los mit de Reems, dat de Rostocker, wo twei Polizisten mit bi wirn, sik vör Angst ünner de Duchten verkrepen. Een von de Warneminner snidd in dat Gefecht dat Enn´, womit de Jöll fast wir, mit´n Metz af un heidi gahn sei mit ehr Jöll. Na, dit was ja nu ne böse Geschicht un dor müsst wat na kamen, äwer as sei dunn de Warminner Bootslüd un Fischers vör Richter un Rat vörladen deden na Rostock, hadd keener denn annen verraden, un de Roxstocker Fischers, de tügen süllen, künnen ok die richtigen nich rutfinnen un antwurten ümmer, wenn sei fragt würden, ob´t dirs´ode de west wir: „magt woll“, bet´t tauletzt de Rostocker Snaters, de uk woll ihren Spaß doran hadden, äwer wür un sei de uk woll ihren Spaß doran hadden, äwer wür un sei de Kirls lopen leten. T´wir ok woll nich rutkamen, wenn nich tauletz de „Geschwätzigkeit“ von dat weibliche Geslecht dortau kamen wir. De Warminner Fischfrugens föhrten dunn jeden Morgen - né Iserbahn un regelmäßige Dampers na Rostock gewt dunn noch nich - mit ne Jöll na Rostock tau Markt - Sei reuderten sick sülwst un segelten uk forsch as de Kirls. So kamen sei uk mal s´Middags mit ehr Jöll von Rostock trügg un raudern an dat Reid an westlichen Aeuwer entlang. De Rostocker Fischers hemmen nu äwers de Gewohnheit, tau de Middagstid ehren Kahn in dat Reid tau trecken, ihr Bodderbrot tau verteren un denn ´n Og full tau nehmen. Na, sön´n Rostocker liggt dunn uk in dat Reid, as de Frugens dor vörbi rudern - un as de Frugenslüd nu enmal dat Mul nich hollen können, dunn hürt hei, wie sei sik von disse Geschicht vertellen: „undat is doch man gaud, dat sei dunn Korl S. un Heine B. nich krägen hemmen ! un Albert H. is ok dorbi west“ usw. Na, dit was nu wat för den Fischer: hei schriwwt sick flink de Nams mit Krid up de Planken von sin Boot un so müssten de, von de sei de Nams nu wüssten, doch noch dran glöwen. Ick glöw, sei hemmen sogor sitten müßt. Dat wir dat En´n von de seeslacht up´n Breitling twischen de Warminner un de Rostocker. Na dorüm sünd sei dei Rostocker noch jetzt nich ganz grön, un süll dor mal een Rostocker in´n Strom fallen, denn will ick hoffen, dat sei em wedder rutehalen un nich etwa raupen: „Smit´n Düvel in´ Strom ! Is´n Rostocker ! Lat´n driwen !”
"De Bidelklut" von Wilhelm Dabelstein im Original Warnemünder Platt 1909
As ik hürt heww, hemmen mi dat nu doch weck äwel namen, as ick nülich dorvon vertellt heww, dat de Warminner, wenn se up´n Rostocker tau spräken kamen, mal dat wurd inne Mund kamen kann: „Smit´n Diwel in´n Strom, lat´n driwen !“ as wenn wi Warminner ´n ganz besonders blauddöstigen Minschenschlag wiren un alle Rostocker vesupen laten wullen. Na, denn ward dat nich anners, denn möt ik Juch man de Geschicht von den „Bidelklut“ vertellen, von den dit Wurd hirkamen deiht. Weit Ji, wat´n Bidelklut is ? Ne ! na, dat is dormit so, as ümmer in de Kaakböker steiht: Man nehme sechs Eier ! usw. Eier hüren dor ok an, uterdem ´n groten Hümpel Mehl, Krinten, Rosinen, Plummen un ik weit nich, wat süß noch all. Wenn Ji´t genau weiten willt, möt Ji ´n oll Warminnersch fragen. Na disse ganze Kram ward tausamenrührt un´n groten Klut ut makt, de Klut kümmt in´n Büdel un dees ward in´t Water hängt un kakt. - dorüm de Nam Büdelklut oder as wi seggen - Bidelklut. Ob de Warminner dit noch öfters maken weit ik nich, wenigstens min Frau, obglik ik ehr dat all öftersen seggt heww, hett mi ümmer noch keenen makt. Na früher , as noch keen Badegäst hierher kemen un Warminn blot ut twee Reegen Hüser bestünn, de Vörreeg un de Achterreeg, wer dat ´n Warminner Nationalgericht un en Frau up´n Rostocker Enn´harr dunn up ´n Sünndag mal sönn Bidelklut farig kakt un will em up´n Töller uté Kök äwer de Deel inne vörrerstuw rinne drägen, üm sick nahsten mit ehren Mann doran tau delekteren, as de Dör upgeiht un ´n Handwarksburß rinnekümmt un üm ne Gaw för´n armen Reisenden biddt. Up de Deel achter de Dör stünn ne Lad, as man sei up´n Lann noch öfter süht un wo Linnentüg un sönn Saken in upbewohrt warden. Up disse Lad stellt de Frau nu den Töller mit den heeten Bidelklut un geiht na achter in de Kök, un halt sik ehr „Biß“, dat heit ´n lütte Büß, so as ne Klock, wo de Lüd ehr lütt Geld in opbewohrten, un giwwt den Handwarksburßen sin´n Dreiling. De Handwarksburß bedankt sik un geiht. In den sülben Ogenblick kümmt ok de Mann tau Hus, un as sei sik nu tau´n Eten dalsetten un de Fru den Bidelklut voné Deel halen will, dunn is de Bidelklut weg. „Den hett de verfluchtige Kirl von Handwarksburß mitnahmen !“ Je ja, je ja , de wir äwerst äwer alle Barg un de Bidelklut was weg un blew weg. Hei wir äwerst achter den Kuffer rullt, denn wil de Deckel von de Lad rund wir, harr de Bidelklut dat Aewergewicht krägen, as de Fru em inne Il up de Lad sett´t hadd, un wir von den Töller tründelt un, wiel de Kuffer von´e Wand affstahn möt, dat sick de Deckel upklappen laten deht, so hadd de Bidelklut Platz un leg nu achter den Kuffert. „Klas Peter ! Klas Peter ! kumm flink her ! De Divel sitt achter´e Lad !“ Na, de Mann rückt ok mit´e Stakfork an un so gahn sei beid den Divel tau Liw un smiten em in´ Strom - un dorvon heit dat noch hüdigendags: „Smit ´n Divel in´Strom ! Lat´n driwen!
"Die Doktorreuse"
"Die Küste im Winter"
Auszüge Warnemünder Anekdoten aus: "Lustig Vertellers von Richard Wossidlo, Johannes Gosselck und Anderen 1924
Gefahrenquelle
- Ein Pastor aus Warnemünde begegnete einmal einem etwa zwölf Jahre alten Jungen aus seinem Kirchspiel und fragte ihn, was er einmal werden wollte.
- Die Antwort lautete voller Stolz: "Seemann!"
- Alle Hinweise des Pfarrers, daß ja schließlich sein Vater und sein Großvater auf See geblieben wären, nützten nichts.
- Der Junge blieb bei seinem Entschluß.
- Schließlich brachte der Geistliche noch das Argument vor:
- "Mien Jüng, mien Vadder un mien Grotvadder sünd ook Pastur west...un in´n Bedd starwt!"
- Nach kurzem Nachdenken gab der künftige Seemann die Antwort:
- "Je, Herr Pastur, denn würr ick mi an ehr Stell gor nich miehr trugen, tau Bedd tau gahn."
Lotsenwache
- Zwei Warnemünder sind auf Lotsenwache. Der eine trinkt Köhm, der andere Kaffee.
- "Wenn du dat Schnapsdrinken nich lettst, warst du ok nich olt", meint der Kaffetrinker.
- "Oh", sagt der andere, "ick heww all immer Schnaps drunken un bin all seßtig Johr bi olt worren."
- "Je", erwidert bedächtig der Kaffeetrinker, "Wenn du kenen Schnaps drunken harst, würst du gewiß all soebentig sin."
Plietsch
- Ein Warnemünder Pfarrer gab sich die allergrößte Mühe, seinen Schäflein das Saufen abzugewöhnen.
- Immer wieder predigte er über dieses Thema, beschwor den "Teufel Alkohol" mit blumenreichen und kräftigen Ausdrücken, erziehlte jedoch nur geringe Erfolge.
- Eines Tages traf der Pastor vor der Vogtei einen betrunkenen alten Fischer seines Kirchspiels, hielt ihn fest und redete auf ihn ein:
- "Mann - Sie hat ja der Alkohol schon richtig düsig gemacht!
- Das kommt vom vielen Saufen!"
- Aber der Alte ließ sich durch diese Strafpredigt nicht beeindrucken und gab seelenruhig zurück:
- "Oh nu Pasting - dat stimmt nich ! So bün ick all ümmer wäst!"
Netzestricker
- Nicht jeder der auf hoher See fährt und Fische fängt, ist nach Warnemünder Begriffen ein Fischer.
- Viele Matrosen auf den Fangbooten zählen nur als Decksmänner.
- Als Fischer gilt nach altem Herkommen nur derjenige, der ein großes Fischernetz ohne fremde Hilfe zu stricken versteht.
- Wer als Decksmann tätig war, mußte von jeher neben anderer schwerer Arbeit auch die gefüllten Fischkisten transportieren.
- Davon bekommt man bekanntlich "lange Arme".
- Mancher der von Natur aus lange Gliedmaßen besitzt, muß es sich gefallen lassen, nur für einen Decksmann gehalten zu werden.
Markierungsboje
- Nach einem alten Warnemünder Aberglauben schwimmen weibliche Leichen im Seewasser mit dem Bauch nach oben, während bei männlichen Wasserleichen der Rücken nach oben zeigt, wobei die Arme und Beine tief im Wasser hängen, so daß nur ihr Gesäß "wie eine Boje" im Wasser sichtbar bleibt.
- Großherzog Paul Friedrich wollte in den vierziger Jahren des 19. Jahrhunderts einmal eine Bootsfahrt unternehmen.
- Doch dem Fischer, mit dessen Kahn er segeln wollte, erschien das Wetter zu gefährlich.
- Als der hohe Gast auf seinem Wunsch bestand, erklärte der Warnemünder ganz entschieden:
- "Tja, wenn Sei will´n, Königliche Hoheit!
- Ick mücht min Noors nich tau ne Boje maken !"
Heiratsantrag
- Ein älterer Fahrensmann aus Warnemünde, der wegen seiner Trunksucht berüchtigt war und schon mehrfach vollkommen bezecht auf der Straße herumgelegen hatte, machte einer älteren alleinstehenden Frau seines Heimatortes einen Antrag:
- "Ick harr woll Lust, di tau friegen! Wat meinst du dortau?"
- Die Frau überlegte nicht lange und erwiederte ohne zu zögern:
- "Süh mol:Ick heff all een Swien in´n Stall, un an een Swien heff ick naug !"
Karfreitag
- Eine ältere Bürgerin Warnemündes bekam am Karfreitag unverhofft Besuch, als sie gerade ihre Strümpfe stopfte.
- Die Verwandschaft wunderte sich natürlich, daß die Frau ausgerechnet an einem so hohen kirchlichen Feiertag eine derart grobe Arbeit vorgenommen hatte.
- Die Alte hörte sich alle Belehrungen geduldig an und gab dan zu verstehen, daß ihr der Feiertag gar nicht bewußt geworden war:
- "Ick wahn achter ut - un tau mi kümmt keener!"
- Dieses Wort machte bald die Runde und wurde noch oft zitiert, wenn ein Mensch fern vom Getriebe des Alltags im Ort vor sich hinlebte...
Angewohnheit
- Kapitäne im Ruhestand (in Mecklenburg lautet die Bezeichnung für diesen Beruf allgemein "Schipper") gingen oftmals am Alten Strom in Warnemünde, wie seit Jahrzehnten gewohnt, eine Schiffslänge auf und ab.
- Sie wiederholten damit gewissermaßen jene Spaziergänge, die sie in früheren Zeiten auf dem Deck ihres Fahrzeugs unternommen hatten.
- Schon an der Zahl der Schritte zwischen den Umkehrpunkten vermochte jeder Zuschauer leicht zu erkennen, wer früher ein größeres und wer ein kleineres Schiff geführt hatte.
Anstand
- Ein Warnemünder Schulmeister besaß ein wenig Ahnung von der Jägerei, weil er selbst oftmals als Treiber mitgewirkt hatte und daher mancherlei Fachausdrücke des Waidwerkes kannte.
- Seiner Schulklasse erklärte er sehr genau die verschiedenen Arten der Jagd und ließ dann seine Schäflein einen Aufsatz darüber schreiben.
- Das Ergebnis entsprach allerdings nicht ganz den Erwartungen.
- So las er etwa: "Der Jäger besitzt eine Flinte.
- Damit geht er in den Wald, klettert die Leiter hoch und legt sich flach auf den Bauch. Das nennt man Anstand!"
Gasparis Warnowreise (um 1790)
- Der in Rostock ansässige italienische Konditor Gaspari fuhr einmal mit einem anderen Italiener, dem Consul Laurino, von Warnemünde im Boot nach Rostock. :Unterwegs hatte der Consul das Unglück in´s Wasser zu fallen, und Gaspari rief in großer Erregung den Schiffern zu:
- "rett´meine beste Freund Laurino! Meine álbe Vermögen für meine beste Freund!" -
- Ein Matrose sprang in´s Wasser und kam gleich darauf wieder empor, statt des schwarzlockigen einen Kahlkopf im Arm hoch hebend.
- Gaspari seinen Freund ohne Perrücke nicht kennend, schrie mit echt italienischer Rücksichtslosigkeit:
- "Tauch´ weg! Tauch´ weg! Das nicht sein meine Freund Laurino!"
Stephan Jantzens gefährlichstes Abenteuer
- Der Warnemünder Lootsenkommandeur Jantzen wurde einmal nach Schwerin gerufen, um als Sachverständiger einen Dampfer zu prüfen, der den dortigen See befahren sollte.
- Nach der Wasserfahrt gab man ihm zu Ehren ein Diner, bei welchem die Herren ihn animierten, von seinem Leben und seinen Fahrten, die er gemacht, zu erzählen. :Schließlich wurde er gefragt, welches wohl das gefährlichste Abenteuer gewesen sei, das er erlebt habe, und zum Entsetzen der Gesellschaft erwiderte er lakonisch:
- "Das war die Fahrt heute, denn das kleine Schiff war dermaßen überladen, daß wir mit Mann und Maus ertrunken wären, wenn die Herren ein bishen unruhig wurden, oder wenn das Wetter nicht so still geblieben wäre!"
Lotsengarn
- In den 1880er Jahren machte Heinrich Schliemann mit seiner griechischen Gattin und seinen zwei Kindern einen mehrwöchigen Urlaub in Warnemünde.
- Er war glücklich, wieder einmal in Mecklenburg zu sein und mit der Bevölkerung plattdeutsch sprechen zu können.
- Schliemann war ein großer Reuterverehrer und Kenner seiner Werke, die in seiner Bibliothek einen Ehrenplatz einnahmen.
- Daß er in seinem mecklenburgischen Urlaub nun wieder die geliebte mecklenburgische Küche enießen konnte, war ebenfalls eine große Urlaubsfreude:
- Erbsen mit Schweineohren und das bekannte "tosamkokte Äten".
- Am liebsten unterhielt er sich mit den alten Fahrensleuten am Hafen.
- Sein Freund wurde ein alter graubärtiger Lotse, ein wahre Riese von Gestalt, ein echter norddeutscher Seebär.
- Dieser Lotse war über 40 Jahre als Matrose und Steuermann auf allen Meeren der Welt umhergekreuzt.
- Er kannte die Meere, das Leben und die Menschen.
- Schliemann erzählte dem alten Seemann von seiner ersten großen Fahrt als Schiffsjunge mit der Hamburger Brigg Dorothee und dem Kenter auf einer Sandbank unweit der Küste von Texel.
- Die 9köpfige Besatzung konnte sich retten, aber verlor alle Habseligkeiten.
- Nur ein Koffer, der des Schiffsjungen, also seiner, schwamm und konnte geborgen werden.
- Nach dieser Schliemann-Erzählung gab es eine kurze Pause beim Lotsen.
- Er prünte mit seinen schmalen Lippen, spuckte seinen Priemtobak in hohem Bogen zur Seite und meinte:
- "Mit Verlöw, min Herr, dat was woll nich dat richtige Geschäft för sei, as Schiffsjung, mit de schwachen Knaken ..." und dabei sah er Schliemann von oben bis unten abschätzend an.
- "Sei hür´n an´n Schriewdisch. Nu will ik Sei man´n anner Geschicht von´n meckelbörgsche Brigg vertellen, de Brigg, de ik stüern müßt, wil uns Käppen krank würd.
- Äwerschrift is "im griechischen Archipel von Seeräuben überfallen und geentert! Se kemen mit ehr Felucce an enen düstern Abend ganz liesing an uns ran, un in´n Ogenblick wieren oewer en Dutzend von dat Hunntüg an unsern Burd klattert.
- Ick harr söß Matrosen, luter echte Meckelbörger von Fischland, bi mi un rep:
- "Jungs nähmt de Handspaken un döscht se up de Köpp."
- Dat geschah denn ok, un den eenen Kierl, wat der öberste von se was, de mit sienen Dolch eenen Schlitz in min Bost stek, packte ik in de Görgel un smeet em oewer Burd.
- To den Stüermann rep ik:
- "Chrischan, nu holl man drup!" un so sägelten wi ehr Felucce in´n Grund. Mann un Muus versupen; Seeräuber kann´t nich aners gahn!"
Schmuggelware
- Geschmuggelt wurde in Rostock von jeher.
- Bei Warnemünde hatten die Behörden die Unterwarnow durch ein langes Querholz verschlossen.
- Jedes einlaufende schiff musste zuerst am Zollschuppen anlegen und wurde genau durchsucht.
- Die heiße Ware kam jedoch auf ganz anderem Wege an der Zollabfertigung vorbei in die Stadt.
- Wo heute Markgrafenheide liegt, befand sich ein zweiter Durchlass zwischen Breitling und Meer, sehr seicht und schlecht zu befahren.
- Es wurde erst beim Ausbau des Stadthafens zu Beginn des 20. Jahrhunderts zugeschüttet.
- Mit flachen Booten konnten Ortskundige diese Durchfahrt benutzen und in dunkler Nacht ihre Ware nach Rostock bringen.
- König aller Schmuggler war zu Beginn des 19. Jahrhunderts Klaus Maes.
- Er verzollte immer einen kleinen Teil seiner Waren in Warnemünde, verkaufte aber später weitaus mehr – nämlich auch die geschmuggelten Partien.
- Das fiel nicht auf und er hatte sich für diese Art von Betrug eine Art von doppelter Buchführung eingerichtet.
Der Kreuzstein
- (NHG)
- Legende:
- Im September 1897 zeigte mir der Forstaufseher Holtz zu Diedrichshagen einen in der Hofmauer des Gehöfts Nr. 9 (Ausbau) zu Gr. Klein eingemauerten Inschriftstein.
- Der Stein hat früher an der Rostock-Warnemünder Landstraße gestanden, ist nach deren Legung (infolge des Chausseebaues) herausgenommen und von Erbpächter Susemil, wie oben gesagt, eingemauert.
- Er hieß "Dat Steenern Krütz", ist auch ein solches; denn er enthält ein Kruzifix und die Inschrift: na X. (Christi) boert. XIIII cxl iar. do. velbernt, coppelow. hir.
- Ich entzifferte die Inschrift und gab sie dem Erbpächter in Abschrift und Druck. Am 26/7 1899 war ich wieder dort, und da hörte ich von der Mutter des Erbpächters bei Erwähnung des Namens Coppelow: "Ja de sall hier ja 1849 (die Schwiegertochter verbesserte die Zahl in 1449) mit'n Damper ümme Welt jagt hebben un dorbi stört sin." - Es hat sich also schon eine neue Legende an den Stein geknüpft um das "vel" zu erklären. Denn vor Entzifferung der Inschrift hatten die Leute überhaupt keine Ahnung mehr davon für wen u. aus welcher Veranlassung der Stein einst errichtet war. Sie hielten die Inschrift für "Hieroglyphen".